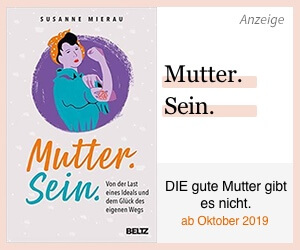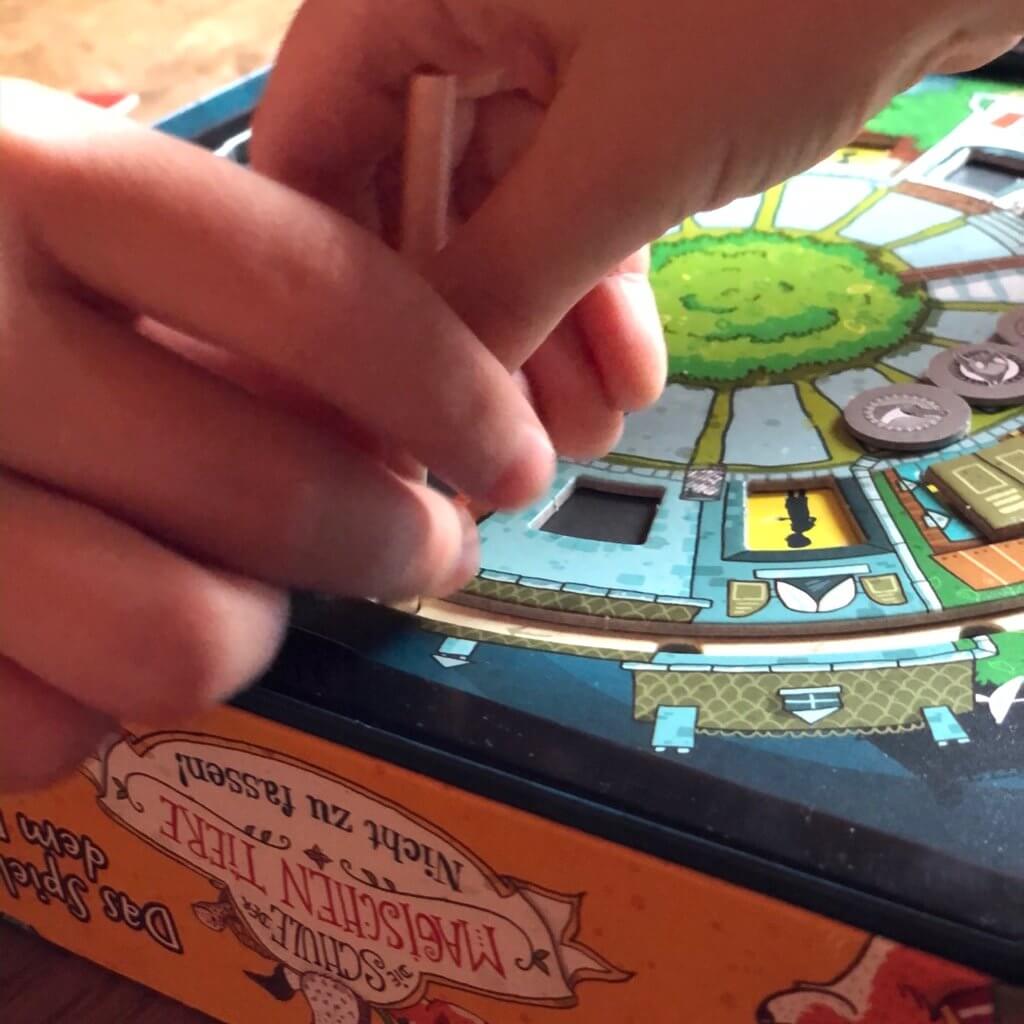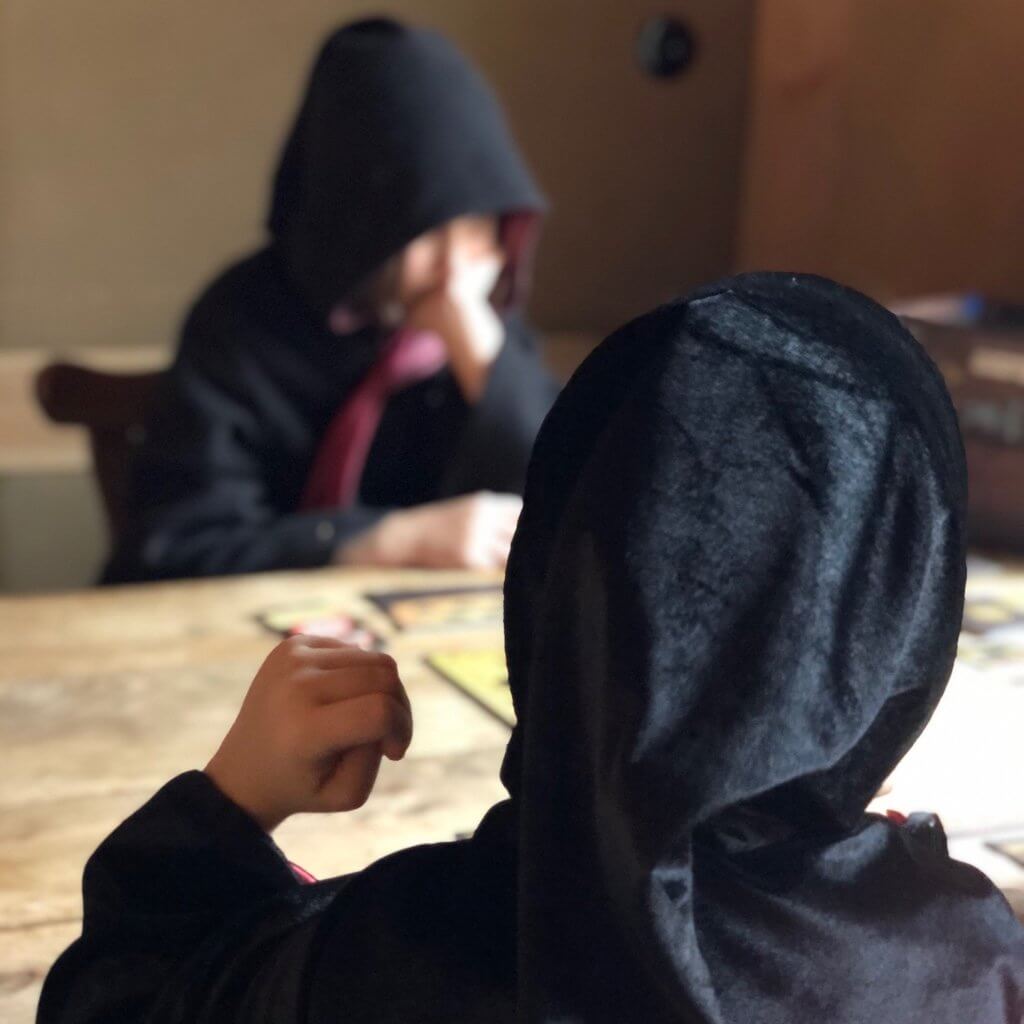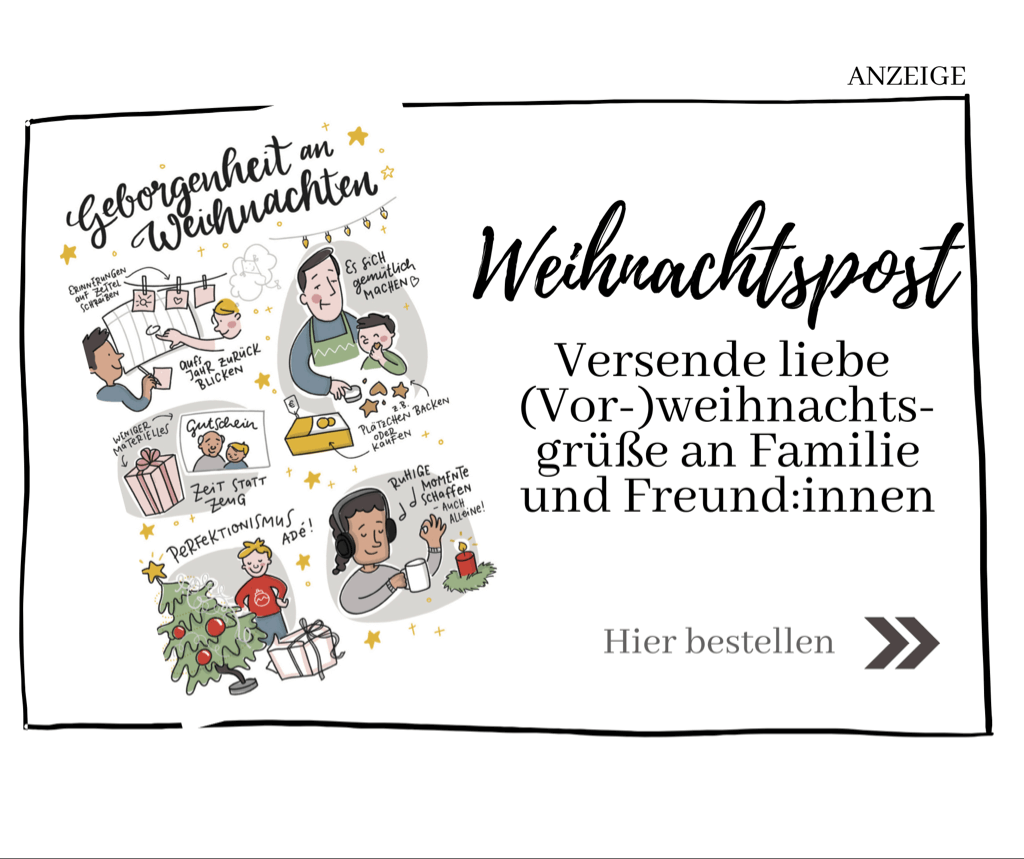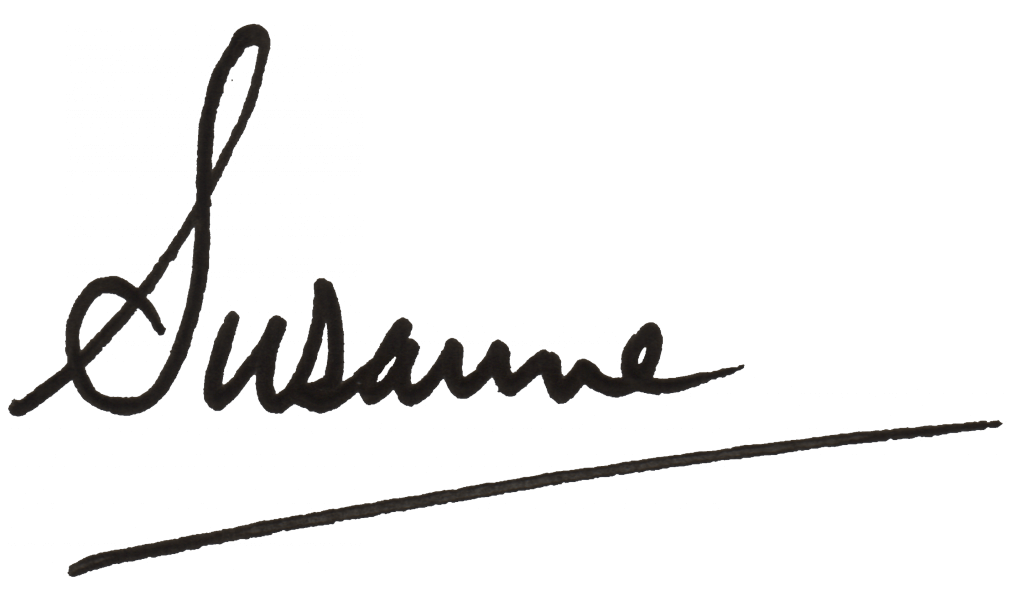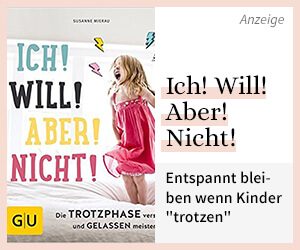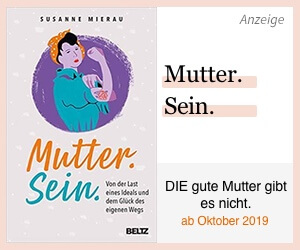„Räum jetzt endlich mal Dein Zimmer auf!“ Diesen Satz sagen so viele Eltern in der Hoffnung, das Kind würde auf einmal die Wohnung aus Erwachsenenaugen sehen, in die Hände klatschen und freudig erst die Kleinteile vom Boden aufräumen und anschließend die restliche Unordnung beseitigen. Tatsächlich aber blicken nach einem solchen Satz oft nur verunsicherte Augen um sich: Schließlich ist doch alles in bester Spielordnung, oder nicht?
Wechseln wir einmal die Perspektive
Sehen wir also einen Augenblick das Zimmer aus der Perspektive des Kindes, vielleicht auch tatsächlich aus der Augenhöhe des Kindes. Da ist die sorgsam aufgebaute Eisenbahn: Holzteil musste in Holzteil gesteckt werden. Die passenden Züge wurden ausgewählt, drum herum noch eine kleine Landschaft gebaut aus Bausteinen und Figuren. Ein Stück daneben liegen die gerade durchgeblätterten Lieblingsbücher auf einem Stapel. Herausgenommen aus dem Regal, in dem die anderen Bücher, die gerade nicht so spannend sind, noch stehen. Da sitzen die Kuscheltiere in Reichweite, eines sieht scheinbar dem Eisenbahntreiben zu.
Das Spiel ist die Arbeit des Kindes. Im Spiel zeigt sich, welche Entwicklungsaufgaben das Kind gerade angeht, wie Fein- und Grobmotorik gerade ausgebaut werden, welche Themen das Kind gerade für sich bearbeitet und was ihm wichtig ist. Das Kinderzimmer spiegelt diese Arbeit wider und ist auch ein Spiegel unserer eigenen Schreibtische, auf denen wir manches Mal die Sachen zusammenstellen, an denen wir gerade arbeiten, auf denen wir die Bücher ablegen, die wir gerade lesen (wollen). All das zeigt sich auch im Raum des Kindes und darin, wie das Kind ihn gestaltet.
Dementsprechend ist es nicht einfach, die so sorgsam zusammengestellten Sachen zur Seite zu räumen. Den so gut aufgestapelten Turm wegzuräumen, die kunstvoll gestaltete Landschaft in Kisten zu verstauen.
Alternativen und Kompromisse
Haben wir also im Blick, welche Bedeutung einige der aufgestellten und in unseren Augen „unordentlichen“ Sachen haben, können wir uns auf den Weg machen, Kompromisse zu finden: Vielleicht gibt es ein Regal, in dem die Bauwerke aufgehoben werden. Oder es gibt einen Tisch oder eine Spielplatte, der/die beim Aufräumen immer unangetastet bleiben kann. Müssen wir die Flut der Kinderbilder und Bastelwerke etwas ausdünnen, können wir Fotos der Werke machen und diese so verewigen.
Wenn doch aufgeräumt werden muss
Natürlich gibt es dann auch Situationen, in denen das Aufräumen nicht mehr verhindert werden kann. Für viele Kinder ist es gut, wenn es eine bestimmte Ordnung und Übersichtlichkeit gibt, damit sie in das Spiel finden können und nicht beständig abgelenkt werden. Muss also aufgeräumt werden, muss das aber nicht in Streit enden. Damit auch das Aufräumen entspannt abläuft, können wir einige Punkte beachten:
- Den Grund für das Aufräumen benennen und dabei aus der eigenen Perspektive reden: „Ich denke, wir müssen mal wieder etwas Ordnung schaffen, damit wir besser laufen können und es einen besseren Überblick gibt.“
- Keine Fragen stellen, wenn etwas nicht zur Diskussion steht. Fragen wir „Findest Du nicht auch, dass wir mal wieder aufräumen sollten?“ kann das Kind „Nein“ antworten – damit ist eine Auseinandersetzung ziemlich wahrscheinlich. Sprechen wir also lieber Fakten aus, als zu fragen, wo wir eigentlich keine anderen Antwortmöglichkeiten zulassen wollen.
- Unterstützung anbieten: Kinder haben ein anderes Verständnis von Ordnung als wir. Ein „Räum mal auf!“ wird kaum den Erfolg bringen, den wir uns vorstellen. Wenn wir allerdings gemeinsam das Aufräumen angehen, ist das Kind engagierter und lernt durch unsere Anteilnahme und Vorbild, wie das Aufräumen ablaufen kann und erwirbt die Kompetenz, es immer mehr selbst tun zu können.
- Besonders wichtige Aufbauten retten (siehe oben).
- Konkrete Anregungen statt diffuses Aufräumen: Da Kinder keine konkrete Vorstellung vom Aufräumen haben, sind konkrete Anregungen viel praktischer: „Ich sammle alle Kuscheltiere ein und setze sie auf das Bett, du sammelst alle Bausteine ein und legst sie in die Kiste.“ oder auch „Ich sammle alle roten Sachen ein, du alle blauen.“
- Praktisch ist es auch – gerade für jüngere Kinder – wenn ein fester Zeitrahmen eingehalten wird: „Ich stelle die Küchenuhr jetzt auf 10 Minuten. So lange räumen wir alles auf. Wenn die Uhr klingelt, hören wir auf.“ Auch ein Aufräumlied kann dem Aufräumen als Ritual einen Rahmen geben. Manchmal sind solche Lieder auch aus dem Kindergarten bekannt: „Aufräumzeit, es ist so weit. Alle Kinder räumen auf!“
- Keine Drohungen wie „Wenn in 10 Minuten nicht alles ordentlich ist, kommt es in die blaue Tüte auf den Müll!“ Kleinkinder können weder mit dem Zeitrahmen etwas anfangen, noch mit unserer Vorstellung von Ordnung. Und größere Kinder werden durch Drohnungen und Stress nur handlungsunfähig und verängstigt, wodurch sie weder aufräumen können, noch lernen, wie Ordnung gemacht wird. Zudem fühlen sie sich machtlos und bedroht in dem wenigen, aber geliebten Besitz.
Aufräumen muss keine ungeliebte Streitsituation sein. Haben wir einen Blick für das kindliche Bedürfnis und die Möglichkeiten des Kindes, können wir das Aufräumen entspannt gestalten.
Eure
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und kindliche Entwicklung. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de