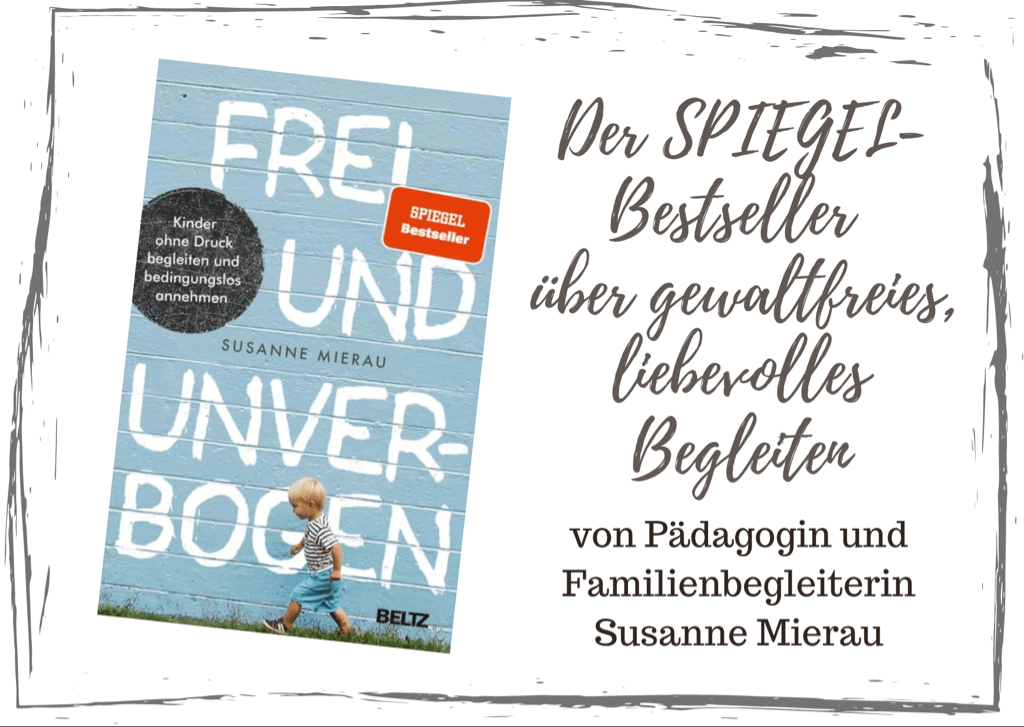Wenn wir uns Familien und besonders Probleme innerhalb von Familien ansehen, blicken wir viel auf das Verhalten von Eltern und Kindern. Wir betrachten Temperamentsdimensionen von Kindern, wir fragen nach den eigenen Erziehungserfahrungen und der Kindheit der Eltern. Wir suchen Probleme besonders im zwischenmenschlichen Bereich. Viel weniger achten wir auf andere Einflussfaktoren. Aus dem Bereich der institutionellen Begleitung von Kindern ist vielleicht einigen die Bezeichnung „der Raum als Erzieher“ bekannt: Die Reggio-Pädagogik betrachtet den Raum und die Raumgestaltung als dritten Pädagogen (der erste Pädagoge ist das Bild vom Kind, der zweite die Fachkraft), der Bildungsprozesse und Interaktionen beeinflusst. So, wie in der außerfamiliären Betreuung, müssen wir aber auch innnerhalb der Familie beachten, dass noch viel mehr Faktoren neben den eigentlichen Personen Einfluss nehmen auf Erziehung: Räume, finanzielle Ressourcen, Stadtplanung etc. – und eben Zeit.
Zeit beeinflusst unsere Handlungen
Die Zeit, die wir haben – oder eben nicht haben – nimmt erheblichen Einfluss darauf, wie wir mit unseren Kindern umgehen können: Wieviel Zeit haben wir, um einen Wutanfall zu begleiten? Und wie verhalten wir uns, wenn wir viel Zeit haben und wie verhalten wir uns, wenn wir wenig Zeit haben, unter Termindruck stehen? Wahrscheinlich werden viele Eltern unter Termindruck weniger geduldig sein, das Kind eher drängen, vielleicht auch schimpfen, um das Kind zu bewegen. Wie gehen wir mit Körperpflegesituationen um unter Zeitdruck? Wie begleiten wir unsere Handlungen sprachlich und wie achtsam und langsam gehen wir mit dem kleinen Körper um, wenn wir Haare kämmen morgens unter dem Stress, losgehen zu müssen und wie wechseln wir die Windeln, wenn wir „schnell machen“ müssen? Aufmerksamkeit, sprachliches Begleiten unserer Handlungen, Vorankündigung des nächsten Schrittes und die Art der Berührung ändern sich, wenn wir weniger Zeit haben für Handlungen. Je grober und weniger achtsam wir sind, desto eher wird das Kind sich dagegen aufbäumen, desto mehr Zeit brauchen wir, desto ungehaltener werden wird.
Zeitmangel führt zu Schlafmangel führt zu Interaktionsproblemen
Doch nicht nur in den konkreten Handlungen wirkt sich der Mangel an Zeit auf unsere Interaktionen aus: Wenn wir zu wenig schlafen, weil wir endlich dann, wenn das Kind schläft, Dinge nachholen wollen, die sonst nicht möglich sind – Partnerschaftszeit, Hobbys, Entspannung -, die ja auch wichtig für uns sind und die wir sonst ansiedeln hinter Arbeit, Haushalt und Kind, dann wirkt dieser Schlafmangel, der eigentlich aus einem Zeitmangel entsteht, wieder auf die Interaktion innerhalb der Familie: Schlafmangel führt zu verschiedenen körperlichen und psychischen Problemen bis Erkrankungen und wirkt sich auch auf unsere soziale Interaktion und Feinfühligkeit aus: Wer müde ist, ist weniger aufmerksam für Feinsignale und insgesamt gereizter. Wie reagieren wir an einem Tag, an dem wir unausgeschlafen sind, auf ein wütendes Kind und wie an einem Tag, an dem wir ausschlafen konnten?
Es kostet Zeit, um neue und andere Wege zu gehen
Selbst der oben genannte Aspekt der Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit und den eigenen Erziehungserfahrungen leidet unter unserem Zeitmangel: Die Auseinandersetzung, vielleicht sogar im Rahmen einer Therapie, benötigt Zeit. Wir brauchen Zeit, um die eigene Kindheit aufzuarbeiten, moderne Erziehungsliteratur mit alternativen Handlungsweisen zu lesen, uns beraten zu lassen und/oder uns mit anderen Eltern auszutauschen.
Zeit ist eine Ressource, die erheblichen Einfluss nimmt auf die Ausgestaltung unserer Beziehung: Wie viel Zeit haben wir, um entspannt mit unseren Kindern umzugehen? Wie viel Zeit haben wir für die verschiedenen Facetten unserer Persönlichkeit – neben dem Muttersein? Und wie viel Zeit haben wir für Selbstfürsorge und Verarbeitung psychischer Verletzungen, die sich manchmal auch erst aus dem Zeitmangel ergeben? Wir bekommen oft vermittelt, wir müssten alles gleichzeitig machen – und können. Als hätten wir Mütter einen Zeitumkehrer wie Hermine Granger in Harry Potter. Die Wahrheit aber ist: Wir brauchen keinen Zeitumkehrer, der dafür sorgt, dass wir eine Stunde zweimal nutzen können. Wir brauchen vor allem das Zugeständnis, dass es Zeit braucht, um für uns selbst und für unsere Kinder da sein zu können.
Susanne Mierau (2022): New Moms for Rebel Girls, S. 174
Erziehungsstil ist nicht nur eine Frage des Wollens. Es ist auch eine Frage der Rahmenbedingungen und der Zeit. Vielleicht sollten wir viel mehr Zeit dafür verwenden, Zeit als „vierten Pädagogen“ zu beachten und dafür sorgen, dass Eltern genug Zeit haben, um ihre Kinder entspannt und bedürfnisorientiert begleiten zu können. Über Zeit zu verfügen, ist leider nicht nur eine Frage der persönlichen Anstrengung und des persönlichen Willens, sondern eine strukturelle Frage unserer Zeit und Gesellschaft.
Eure
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und kindliche Entwicklung. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und kindliche Entwicklung. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de