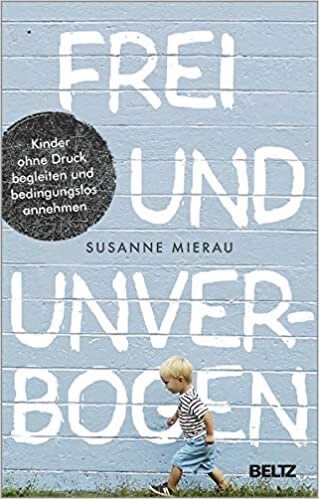Immer wieder können wir lesen und hören, wie wichtig es ist, dass Kinder eine psychische Widerstandsfähigkeit ausbilden können, um mit schwierigen Ereignissen im Leben gut umgehen zu können. Dabei gelangt vor allem immer wieder in den Blick, dass wir die respektieren, liebevoll mit ihnen umgehen und sie selbstwirksam sein können. Ein anderer wichtiger Bereich, der allerdings weniger oft benannt wird, ist der Umgang mit Fehlern und die Bedeutung der Erfahrung, dass Fehler in Ordnung sind.
Eltern haben keine perfekte Voreinstellung
Fehler gehören zum Leben dazu. Versuch und Irrtum – so bewegen wir uns oft durch den Alltag und nicht selten baut auch Erziehung ein wenig darauf auf, dass wir bestimmte Handlungsstrategien ausprobieren und sehen, ob sie zu uns und unserer Familie passen – oder eben nicht. Oft kennen wir nicht von Anfang an die richtige Antwort und sind auch erst Lernende auf dem Weg des Elternseins. Und dies ist wichtig: Wir müssen uns als Eltern flexibel anpassen können an das Kind, das zu uns kommt und lernen, mit dem Kind umzugehen, wie es ist. Deswegen ist es kein Makel, dass wir nicht von Anfang an ein ganz bestimmtes Eltern-Verhaltensschema abspulen, sondern eher grob wissen, was wir machen und uns nach und nach auf das individuelle Kind, das wir begleiten, einstellen.
So sehr es uns manchmal das Gefühl drückt, dass wir nicht sofort eine richtige Antwort wissen oder Fehler machen, so normal ist es auch und hilfreich, damit wir den wirklich passenden Weg finden. Oft haben wir erlernt, dass wir keine Fehler machen sollten, dass Fehler sogar bestraft werden und versuchen daher, in möglichst vielen Bereichen ein solches Handeln zu vermeiden und schämen uns, wenn wir doch vermeintliche Fehler begehen. Ohne zu sehen, dass uns diese Fehler bereichern in dem Wissen, wie wir es anders besser machen können und beim nächsten Mal schneller einen leichteren Weg einschlagen.
Kinder profitieren von Fehler-Offenheit
Eine Toleranz und Akzeptanz gegenüber eigenen Fehlern hilft aber nicht nur uns Eltern und entspannt, sondern kann auch den Kindern helfen: Sie sehen, dass auch wir manchmal straucheln, Probleme haben, etwas falsch machen und daraus dann Schlüsse ziehen und neue Handlungsstrategien entwickeln. Es nimmt Druck von den kindlichen Schultern, wenn wir offen mit unseren Fehlern umgehen und Kinder nicht denken müssen, alles perfekt machen zu müssen. Wenn sie sehen dürfen, dass alle Menschen auch Fehler machen, erleben sie sich selbst bei Fehlern nicht so inkompetent, dass sich dies negativ auf ihr Selbstbild auswirkt.
Als Eltern Fehler offen und unterstützend begleiten
Fehler gehören zum Leben dazu – gerade auch bei Kindern. Wir können bei den Dingen, die unsere Kinder vor Herausforderungen stellen, unseren eigenen Ansprüchen gegenüber sowie den Fähigkeiten des Kindes gegenüber von Anfang an Fehlertoleranz entgegen bringen: „Das zu lernen braucht oft Zeit, die nehmen wir uns.“ – So zeigen wir Verständnis und gleichzeitig Unterstützung. Auch ist es wichtig, die Selbstwirksamkeit des Kindes immer wieder zu betonen: „Das ist kompliziert, hast Du eine Idee, was getan werden kann, um das Problem zu lösen?“ Wir müssen nicht beständig eingreifen und Lösungen vorweg nehmen, sondern vielmehr den Raum bieten, über Lösungen zu sprechen und eigene Ideen zu entwickeln. So lernen Kinder, kreativ mit Herausforderungen und Fehlern umzugehen und sich nach und nach selbständig auf Problemlösungssuche zu begeben. Weil sie Wissen, dass ein Fehler keine Sackgasse ist, sondern man einen anderen Weg suchen kann.
Eure
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und kindliche Entwicklung. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de
Foto: Ronja Jung für geborgenwachsen.de