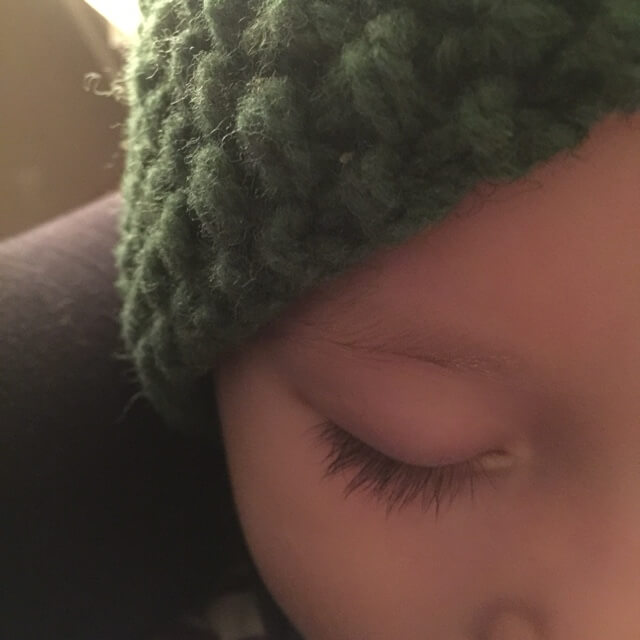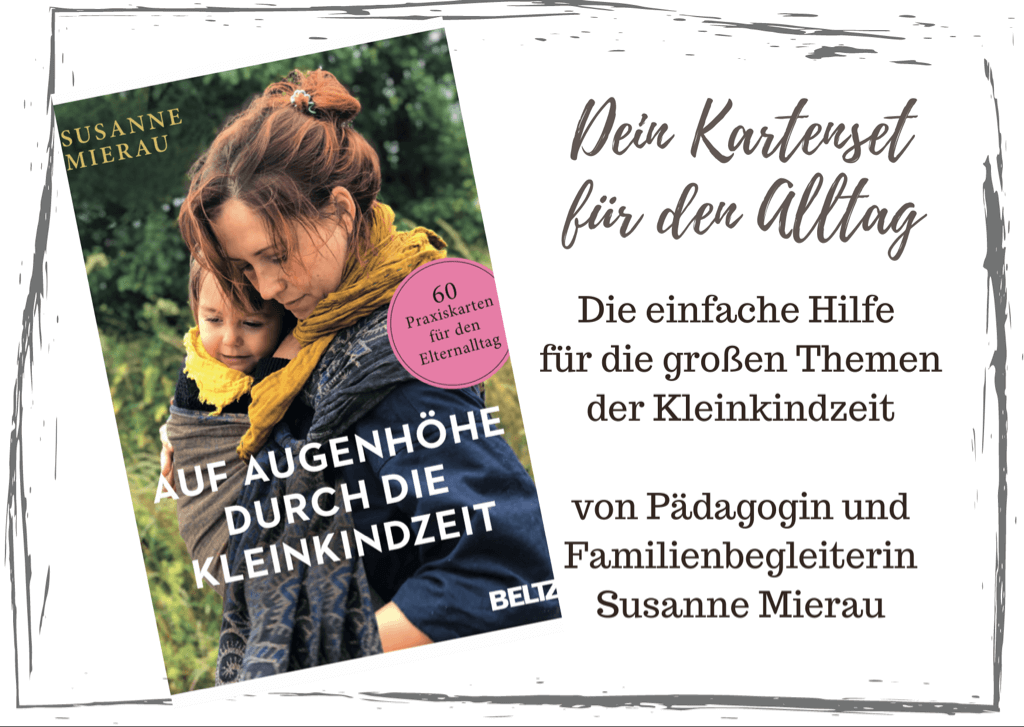Noch nicht groß und nicht mehr klein. Schon laufen können, aber irgendwann auf den Arm genommen werden müssen, weil die Beine doch nicht alles tragen. Noch nicht so hoch gewachsen, um alles überblicken zu können. Nicht mehr so klein, um immer hoch genommen zu werden. Das Hemd zuknöpfen wollen, aber noch nicht können. Überhaupt: So viel wollen und es oft nicht alleine schaffen. Immer irgendwo dazwischen sein. Kein Baby mehr, aber auch noch kein Schulkind. Weiterlesen
Kategorie: Kleinkind
Wenn Kinder weinen…
Weinende Kinder berühren uns. Ganz tief in uns sind wir berührt und haben den Wunsch, dieses Weinen beenden zu wollen. Denn: ein Weinen ist immer ein Signal. Es sagt uns etwas über das Kind. Es fühlt sich nicht wohl, es hat sich verletzt, vielleicht sogar gibt es einen gefährlicher Grund. Doch wie wir damit umgehen, kann ganz unterschiedlich sein. Ein „Hör auf zu weinen“ mag das Weinen beenden, aber es ist ein anderes Ende als nach einem „Warum weinst Du?“ zu fragen. Weiterlesen
Kindliches Verhalten ergibt immer Sinn
Warum tut er/sie das? An manchen Tagen hallt diese Frage immer wieder durch meinen Kopf. Bei jedem meiner Kinder: dem Schulkind, dem mittleren Kind und dem Baby. Weiterlesen
Ein Tag mit einem Dreijährigen
Während mein Kind schläft, sitze ich hier und denke über den Tag nach: Darüber, wie kompliziert das Leben manchmal ist mit einem dreijährigen Kind. Kompliziert für mich als Mutter, für den Vater, für die große Schwester, den kleinen Bruder und natürlich vor allem auch für dieses Kind, das ja nicht aus seiner Haut kann. Das das Leben ungerecht, andere Menschen bevormundend, sich selbst zu klein oder zu groß findet und überhaupt. Weiterlesen
Attachment Parenting und alles wird gut?
Ich wünschte manchmal, es gebe das Patentrezept. Das Rezept mit dem alles gut wird. In den vielen Jahren, in denen ich schon mit Eltern arbeite, habe ich nämlich so viele ganz wunderbare Eltern kennengelernt. So viele Eltern, die Probleme hatten mit der Elternschaft, mit ihren Kindern oder Babys und die von außen betrachtet aber einfach tolle Eltern sind. Wie gerne hätte ich ihnen für die Probleme, mit denen sie zu mir gekommen sind, eine ganz einfache Lösung angeboten: Du musst Dein Baby nur zu Dir ins Bett holen und alles wird gut. Oder: Du musst es nur jeden Tag soundso viele Stunden an Deinem Körper tragen und es wird das zufriedenste Baby der Welt. Wir alle wünschen uns das Beste für unsere Kinder und wir tun unser möglichstes, damit es ihnen gut geht. Wir Eltern sind gute Eltern, auch wenn wir es manchmal nicht fühlen. Vielleicht auch gerade dann, wenn wir es nicht fühlen, aber es uns so sehr wünschen zu fühlen: Denn wir geben so viel dafür, dass es unseren Kindern gut geht und denken darüber nach.
Nicht nur Eltern nehmen Einfluss auf Kinder
Aber es ist ein Märchen, dass es das eine Rezept gibt mit dem alles gut wird. Es ist ein Märchen, an das wir Eltern manchmal gerne glauben wollen, weil es uns im Alltag so sehr helfen würde. Weil wir denken: Es muss doch irgendwas geben, durch das es besser wird. Und auf der anderen Seite setzen wir uns selbst damit unter Druck: Ich habe etwas falsch gemacht, ich habe nur noch nicht die eine, wirkliche Wahrheit gefunden, durch die alles gut wird, durch die ich die perfekte Mutter oder der perfekte Vater werde und mein Kind durchschläft, gut isst und/oder sozial angepasst ist. Die Wahrheit ist: Es gibt kein immer gelingendes Rezept. Es gibt gute Zutaten, mit denen wir unseren Kindern einen guten Weg ebnen können. Es gibt Verhaltensweisen, die es unterstützen, dass unsere Kinder eine sichere Bindung aufbauen und auf dieser Basis viele Dinge im Leben leichter fallen. Aber es gibt kein Patentrezept für ruhige Nächte, für gelingendes Stillen oder die super beste Geburt. Denn: Wir sind nicht die einzigen, die auf die Entwicklung unseres Kindes Einfluss nehmen. Wir leben in einer Gesellschaft, die Einfluss nimmt, in Häusern, die durch Raumklima, Schimmelpilze oder Nachbarn Einfluss haben, in Städten mit viel Verkehr, Feinstaub, Lärm oder weniger davon, in großen Familien mit viel Unterstützung oder kleinen mit gar keiner. Wir haben eine Vergangenheit, die uns in unserem Verhalten und unserer Toleranz bei aller Anstrengung immer wieder beeinflusst und Erinnerungen hervor holt. Und das wichtigste: Wir haben Kinder, die eigene Persönlichkeiten sind mit einem eigenen Temperament.
Wenn wir annehmen, dass die volle Verantwortung für das Glück oder Unglück unserer Kinder allein auf unseren Schultern lastet, sind wir beeinflusst von der veralteten Vorstellung, unsere Kinder wären nur Gefäße, die wir füllen. Ton, den wir unter unseren Händen formen. Aber wir wissen heute, dass das nicht stimmt. Wir Eltern sind BegleiterInnen auf dem Weg unserer Kinder, die von sich aus ihr Temperament, ihr Wesen mitbringen. Wir können an ihrer Seite gehen, sie begleiten und stützen, aber wir können sie nicht genau so formen, wie wir es wollen.

Attachment Parenting und „High Need“ Kinder
Und genau das ist auch der Grund, warum auch Attachment Parenting kein Rezept ist, durch das ein sorgenfreies Leben als Eltern garantiert ist. Wir können mit bestimmten Verhaltensweisen unsere Kinder stärken und ihnen liebevoll begegnen auf ihrem Weg und sie auf diese Weise stark und selbstsicher für das Leben machen. Aber wir können – und sollten – nicht versuchen, ihr Temperament zu ändern. Mit manchen Kindern ist die Kommunikation von Anfang an schwieriger, mit anderen leichter. Es kann auf Seiten der Eltern und der Kinder dafür Gründe geben, die es zu erforschen gilt. Wenn Kinder mit besonderen Bedürfnissen in unser Leben treten, reicht es eben nicht aus zu sagen: Na Du musste dieses Kind nur genug tragen/stillen/im Familienbett schlafen lassen damit alles gut wird. Auf diese Weise funktioniert Attachment Parenting nicht.
Es gibt Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder sagen wir: mit noch besondereren Bedürfnissen als andere oder stärkeren Bedürfnissen. Woher diese stärken Bedürfnisse kommen, ist unterschiedlich. Es ist eine Frage des Temperaments, kann auch organisch bedingt sein oder sozial. Doch warum genau das Kind so ist, spielt im ersten Schritt keine Rolle. Es geht nur darum zu sehen, dass ein Kind so ist und deswegen andere Anforderungen an die Eltern stellt als ein Kind, das vielleicht ein sanfteres Temperament hat. Deswegen ist es nicht nur anmaßend, sondern vor allem auch falsch, diesen Eltern zu sagen, welche Dinge sie nun tun könnten, um ihr Kind zu ändern. In vielen Fällen lässt sich ein „high needs“ Kind nicht einfach so ändern – auch wenn die Eltern täglich ihr bestes geben, damit es weniger fordernd, weniger laut, weniger anders ist als andere.
Bindungsorientiert zu leben mit einem Kind ist immer von Vorteil. Egal was für ein Temperament das Kind hat, wie es ist, welche Besonderheiten es in das Leben mit einbringt. es hilft langfristig, aber es ist keine kurzfristige Möglichkeit, um ein Kind zu ändern. Gerade „High need“ Kindern kann es für ihren späteren Weg eine große Hilfe sein, wenn wir sie bindungsorientiert wachsen lassen, damit sie ihr Leben selbstbewusst und gut leben können. Aber es ändert nichts daran, dass sie nun einmal stärkere Bedürfnisse haben als andere.
Ich habe ein „high need“ Kind. Es war ein „high need“ Baby und es hat sich in den Jahren nichts daran geändert, dass es immer mehr Zuwendung brauchte auf vielen Bereichen als das Geschwisterkind. Es war auch für mich ein harter Weg zu erkennen, dass ich – egal wie sehr ich stillte, trug, im Bett schlafen ließ, auf Signale achtetet – nichts daran ändern konnte, dass dieses Kind eben so ist, wie es ist. Ich habe gelernt, es anzunehmen. Es war eine nicht einfache Zeit, denn sie rüttelte auch ein wenig an meinen Vorstellungen mit dem Gedanken: Aber es muss doch irgendwas geben, dass… Es gab nichts außer der Zeit und dem Verstehen und Annehmen.
Ist ein Kind annehmen Aufopferung?
Einen Menschen wirklich in seinem Wesen zu erkennen ist wohl das größte Geschenk, das wir ihm machen können. Denn es bedeutet: Von unseren Ansichten und unseren Vorbehalten abzurücken und sich einzulassen. Manchmal ist es nicht einfach,von vorgefertigten Bildern im Kopf Abstand zu nehmen und neu und offen auf einen Menschen zu zu gehen. Doch wenn wir diesen Weg gehen, dann ergibt sich ein tieferes Miteinander, ein gleichwertiges: Ich sehe Dich wirklich und ich nehme Dich so an.
Wenn wir bindungsorientiert Leben mit unseren Kindern, müssen wir nicht alles machen vom Stillen über Tragen bis Windelfrei. Wir suchen uns die Sachen aus,die zu uns und unserem Leben passen und gehen unseren persönlichen Weg. Es gibt nicht das eine Rezept für ein gelungenes Familienleben, aber es gibt gute Zutaten. Und nein: Wir Eltern müssen uns nicht aufopfern, sondern wir gestalten das Leben genau so, wie es zu uns passt.
Wenn wir ein Kind haben, das besondere Bedürfnisse hat, müssen wir uns ebenfalls nicht aufopfern. Es ist sogar besonders wichtig, dass wir gerade dies nicht tun, sondern mit unseren Kräften haushalten, Grenzen erkennen und sorgsam mit uns selbst umgehen. Wir geben, was wir geben können – wie es alle Eltern der Welt tun möchten. Und wir sind keine schlechten Eltern, weil wir an Grenzen kommen oder nicht den nicht-existenten Zauberknopf finden.
Es gibt ihn nicht, den Zauberknopf. Das ist die schlichte Wahrheit. Es gibt gute Dinge, die wir für unsere Kinder tun können in dem Rahmen, der uns persönlich möglich ist. Elternschaft bedeutet gerade auch, nicht über die eigenen Grenzen zu gehen, damit wir für unsere Kinder da sein können. Wir müssen nicht 150% geben, wenn wir dann ausgebrannt sind und nur noch 50% Energie haben für lange Zeit. Es reicht aus, einfach weniger zu geben, wir müssen nicht perfekt sein, sondern nur gut genug.
Eure

Anstoß für diesen Beitrag gab der Aufruf von Frau Chamailion
Merke Dir diesen Artikel auf Pinterest

Klarheit – wie wir mit Kindern reden sollen
„Könntest Du das bitte aufräumen?“ frage ich meine Tochter. „Ja, aber ich mache jetzt etwas anderes.“ antwortet sie mir und hält mir dabei wieder einmal einen Spiegel vor, der mir im Alltag so hilft und mich nachdenken lässt. Ich wollte, dass sie jetzt aufräumt, vor dem Abendessen. Aber anstatt es wirklich so zu sagen wie ich es meine, habe ich es in einer freundlichen, recht unverbindlichen Aussage verpackt. Sie antwortet genau so, wie es ist: Ja, sie könnte tatsächlich jetzt aufräumen, aber sie tut es nicht. Ich könnte mich nun ärgern über diese Antwort, aber eigentlich liegt das Problem an einer ganz anderen Stelle: Warum formuliere ich nicht klar, was ich meine? Weiterlesen
Mit 2 Jahren
Wenn man von den 2jährigen spricht, dann kommt schnell das Thema „Trotzalter“ auf. Es wird davon berichtet, wie anstrengend Kinder in diesem Alter seien, wie große Konflikte es geben würde und wie schwer sich manchmal der Alltag gestalten ließe. Ich habe schon einmal darüber geschrieben, dass es meiner Meinung nach kein Trotzen gibt, sondern eher den Willen des Kindes, es einfach selbst zu tun. Kinder mit 2 Jahren wollen sich erproben, sie wollen die Welt begreifen mit allen Sinnen, wollen Dinge erfahren, Neues ausprobieren. Sie wollen sich ein Bild machen von dem, was sie umgibt und dazu müssen sie ihre Umgebung verstehen. Weiterlesen
Ich fühl wie Du… oder doch nicht?
Manchmal ist das gar nicht so einfach zwischen den Geschwisterkinder, wenn sie sich nicht verstehen. Oder zwischen Kindern auf dem Spielplatz. Und zwar nicht nur nicht verstehen im Sinne von Streiten, sondern nicht verstehen im wahren Sinne des Wortes: Sie verstehen nicht, was der andere sagt und denkt und darum streiten sie. Denn ein Kind ist noch kleiner und kann sich noch nicht in das andere hinein versetzen. Weiterlesen
Ein Kleinkind stillen!?
„Stillst Du eigentlich noch?“, fragte mich kürzlich eine Freundin, „Ich habe Euch nämlich lange nicht mehr stillen gesehen.“ Mein Sohn ist nun 2,5 Jahre alt – und ja, ich stille ihn noch. Ich stille ihn nicht mehr viel und nur sehr selten in der Öffentlichkeit. Nach und nach wurde die Nachfrage nach dem Stillen geringer: er ist mit anderen Dingen beschäftigt und fragt nur in bestimmten Situationen nach der Muttermilch. Daran, in welchen Situationen er jedoch stillen möchte, sehe ich, warum das Stillen eines Kleinkindes auch durchaus heute noch seinen Sinn haben kann.
Weiterlesen„Ist doch nicht so schlimm!“ Ist es doch. – Über das Trösten
Kinder sind oft erstaunlich robust: Sie lernen zu krabbeln, sich hin zu setzen und zu laufen. Und dabei machen sie immer wieder auch unsanfte Erfahrungen. Sie stürzen, sie holen sich blaue Flecken und Schürfwunden. Und all diese Erfahrungen sind leider auch wichtig, denn das Baby und Kleinkind muss lernen, wie es sich richtig bewegt, wie es richtig vom Stehen zum Sitzen kommt und es muss auch lernen, wie es sich beim Fallen gut abrollen kann, um schlimme Verletzungen später zu vermeiden.
Genauso wie das Kind jedoch diese Erfahrungen benötigt, braucht es in solchen Situationen auch eine andere Erkenntnis: Es ist jemand da, der mich wahrnimmt, der meine Gefühle spiegelt, ihnen überhaupt erst Worte gibt, und mir dadurch auch ein Bild über mich selbst vermittelt. Der mir vermittelt: „Ich sehe deinen Schmerz oder dein Erschrecken. Es ist berechtigt, wie du fühlst. Du fühlst! Ich bin für dich da. Es wird wieder gut.“
Wie sich das Fühlen entwickelt
Wenn ein Baby auf die Welt kommt, weiß es anfangs all die unterschiedlichen Gefühle noch nicht zu deuten. Hunger, Durst, Unwohlsein durch eine volle Windel, Angst, Freude, Glück… Es gibt so vieles zu lernen und zu entdecken. Das Baby lernt in den ersten Lebensjahren, all diese unterschiedlichen Empfindungen kennen und deuten. Dafür braucht es aber ein Gegenüber, das ihm all das verständlich erklärt. Die Bindungsperson nimmt die Signale des Babys wahr, deutet sie und erklärt sie: „Oh, da hat wohl nun jemand Hunger.“ oder „Du brauchst wohl eine neue Windel.“ Der Psychoanalytiker und Hirnforscher Allan N. Schore bezeichnet die Rolle der Mutter (wir können dies aber auch auf andere nahe Bezugspersonen übertragen) im ersten Lebensjahr deswegen auch als „Hilfskortex des Babys“ – sie ist das Großhirn des Kindes, das ihm die Welt erklärt. Erst mit 3 Jahren kann das Baby die Emotionen anderer gut verstehen, sich in sie recht gut hinein versetzen und auch seine eigenen Gefühle besser steuern. Das kann es aber nur dann, wenn es vorher von der Bindungsperson gelernt hat, wie das geht.
Kinder lernen durch feinfühliges Spiegeln
Wir alle kennen auch ähnliche Situationen: Das Kind tut sich weh, es weint, wir nehmen es in den Arm und sagen: „Oh, du hast dir weh getan. Ja, das tut weh.“ vielleicht auch „Oh nein, der Stuhl steht ja ganz ungünstig, so dass du dich daran gestoßen hast.“. Es wird versprachlicht, was passiert ist. Unsere Stimme ist ein Singsang, auch wenn die Augen aufgerissen sind. Wir mildern das Geschehen ab, beruhigen so das Kind. Dabei bleibt jedoch die Botschaft erhalten und auch, dass wir Gefühle in Worte verpacken. Denn nur so kann das Kind auch lernen, dass man Gefühle versprachlichen kann. Eine wichtige Eigenschaft für das ganze Leben. Wer wegschaut und die Verletzung nicht wahrnimmt oder gar negiert mit einem „Hat ja nicht weh getan!“, nimmt dem Kind auch die Möglichkeit, die Fähigkeit zu entwickeln, selbst darüber zu sprechen. Das Kind kann keine richtige Wahrnehmung von sich selbst entwickeln und verhält sich nicht so, wie es eigentlich sollte, da es sich nicht richtig selbst fühlen kann. Vielmehr verhält es sich so, wie es gelernt hat, sich zu verhalten. Diese andere Selbstwahrnehmung und das Fehlen der Wahrnehmung der wirklichen Gefühle und Bedürfnisse kann sich das Leben lang forttragen und langfristig Folgen nach sich ziehen.
Warum Zuwendung wirklich gegen Schmerzen hilft
Wir wissen es doch eigentlich selbst: Wenn es uns nicht gut geht, hilft es oft, von einem Menschen in den Arm genommen zu werden. Es ist nicht nur das Gefühl, dass jemand da ist für uns, sondern die Berührung löst auch wirklich etwas in unserem Körper aus. Durch respektvolle (!) Berührungen werden im Gehirn Rezeptoren stimuliert, wodurch Stresshormone abgebaut werden können. Sogar liebevoller Blickkontakt löst bereits eine solche Reaktion aus. Fehlt die liebevolle Zuwendung aber längerfristig, entwickeln Kinder sogar weniger Rezeptoren, d.h. sie können sich generell schwieriger beruhigen. Sind Kinder gestresst oder ängstlich, können sie weniger gut neue Informationen aufnehmen: das Lernen ist erschwert.
Natürlich gibt es auch Situationen, in denen Kinder sich verletzten und scheinbar keinen Schmerz fühlen. Sie stehen auf und rennen weiter. Auch das ist in Ordnung. Wir müssen Kinder nicht dazu anhalten, sich verletzt zu fühlen. Aber wir sollten ihnen dann, wenn sie Zuwendung und Trost brauchen, den Raum dafür geben. Wir können Fragen: „Hast Du dich verletzt, brauchst du Hilfe?“ und die Antwort des Kindes so annehmen, wie das Kind sie formuliert.
Tröstbarkeit ist unterschiedlich
Kinder unterscheiden sich in so vielen einzelnen Punkten: Im Tempo ihrer Entwicklung, in ihrem Aussehen, aber auch in den vielen kleinen Dingen, denen wir kaum Aufmerksamkeit schenken in unserem Alltag und von denen wir oft pauschalisierende Aussagen machen wie „Alle Babys beruhigen sich schnell, wenn sie auf den Arm genommen werden.“ Tatsächlich aber ist die Tröstbarkeit eines Babys genauso individuell wie die beispielsweise die Erregbarkeit: Was einige Babys geduldig wegstecken, führt bei anderen schnell zu starkem Weinen. Einige Kinder möchten getragen und gewiegt werden, andere werden gerne mit Körperkontakt und Geräuschen getröstet. Als Eltern müssen wir herausfinden, was unser Kind braucht, was ihm hilft.
Warum wir es so schwer haben, liebevoll mit Kindern umzugehen
All diese Informationen zeigen, dass es sehr sinnvoll ist, wenn Kinder liebevoll begleitet werden. Wenn wir ihnen nicht sagen, dass „sie sich nicht anstellen sollen“ oder „Jungs weinen nicht!“ oder wir gar behaupten „Tut doch gar nicht weh.“. Stürze und Verletzungen erschrecken oft oder tun weh und wir müssen dies aufnehmen, für das Kind übersetzen und trösten. Und doch tun wir uns besonders hierzulande so schwer damit, Kinder zu trösten. Immer wieder gibt es den Vorwurf, man würde sein Kind verziehen oder verweichlichen, wenn man es oft in den Arm nimmt und auch bei „Kleinigkeiten“ tröstet.
Leider ist dieser Umgang mit dem Kind noch immer unserem geschichtlichen Erbe geschuldet. Wenn wir vom Verwöhnen sprechen, vom Lob der Disziplin, von Gehorsam und Abhärtung, dann sind das alles Begriffe, die die Erziehung und Denkansätze vergangener Jahrzehnte wiederholen.
Es wundert also nicht, wenn wir auf andere Eltern stoßen, die von ihren Kindern das Nicht-Weinen verlangen. Vielleicht wissen sie es nicht besser. Wahrscheinlich sind sie selbst mit diesen Argumenten aufgewachsen, die sich in ihren Köpfen hartnäckig festgesetzt haben. Sicher ist aber, dass es an uns liegt, dieses Denken und diese Tradition endlich zu beenden. Nehmt also Eure Kinder in den Arm, tröstet sie und lasst sie Kinder sein – so, wie Ihr es Euch als Kind ganz sicher auch gewünscht hättet.
Eure
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und kindliche Entwicklung. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de
Weiterführende Literatur:
Mierau, Susanne (2019): Mutter.Sein. Von der Last eines Ideals und dem Glück des eigenen Wegs. – Weinheim: Beltz.
Mierau, Ssuanne (2016): Geborgen wachsen. Wie Kinder glücklich groß werden. München: Kösel.
Mierau, Susanne (2017): Geborgene Kindheit. Kinder liebevoll und entspannt begleiten. München: Kösel.
Brisch, Karl Heinz (2010): SAFE. Sichere Ausbildung für Eltern. – Stuttgart: Klett-Cotta.
Ustorf, Anne-Ev (2012): Allererste Liebe: Wie Babys Glück und Gesundheit lernen. – Stuttgart: Klett-Cotta.