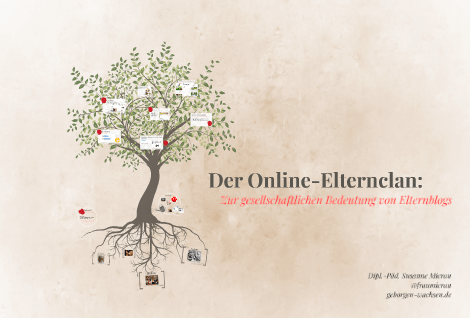Am 11. Oktober habe ich auf dem Attachment-Parenting-Kongress in Hamburg über „Bindung und Berührung“ gesprochen, eines meiner absoluten Herzthemen. Vieles in der Eltern-Kind-Beziehung lässt sich genau darauf zurück führen, bestärken, verbessern. Auf die Berührung kommt es an, vom Anfang bis zum Ende unseres Lebens: Weiterlesen
Schlagwort: Bindung
Mein Vortrag auf der re:publica 2014: Der Online-Elternclan: Zur gesellschaftlichen Bedeutung von Elternblogs
Heute habe ich auf der Re:publica über den Online-Elternclan und seine gesellschaftliche Bedeutung gesprochen. Geschrieben habe ich ja bereits an anderer Stelle auch darüber. Kurz zusammengefasst geht es hierum:
Medial begeisterte Eltern haben es schwer: Mit Smartphone in der Hand wird ihnen Fürsorgelosigkeit und Ignoranz des Kindes vorgeworfen. Andererseits werden ins Netz gestellte Fotos durch Katzenbilder ersetzt oder es wird stolzen Eltern vorgeworfen, inkompetent mit den Persönlichkeitsrechten des Kindes umzugehen. Elternblogs sind zwar in Mengen vorhanden, werden jedoch als redundant betrachtet.
Doch gerade diese Netzgemeinschaft hat eine besondere gesellschaftliche Bedeutung.: Betrachtet man die Menschheitsgeschichte, wird klar, dass Menschen stets in Gruppen zusammen lebten, die zur gegenseitigen Unterstützung dienten. In der modernen Gesellschaft mit ihrer Mobilität und Vereinzelung ist das Clanleben kaum noch möglich. Viele Familien sind zu einer Mobilität gezwungen, die das Beisammensein mit der Herkunftsfamilie nicht mehr ermöglicht. Online-Clans fangen die Unterstützung durch die fehlende Familiengruppe auf: Rat bei Krankheiten wird schnell über Twitter eingeholt, Kindermodetrends über Facebookgruppen geteilt, Kinderzimmertipps bei Pinterest illustriert. Der Onlineclan ersetzt die Familie und ist jederzeit erreichbar.
Auf dieser Basis stellt sich eine bedeutende Frage: Wenn wir Erziehungstipps und Hilfen über das Netz verbreiten, welchen Platz nehmen Socialmediakanäle ein, die Inhalte heraus filtern? Durch das Löschen von Still- und Geburtsbildern wird dann nicht nur in die Persönlichkeitsrechte eingegriffen, sondern auch in die Kultur.
In Zeiten, in denen Familien nicht mehr in Clans zusammen leben, wo Stillen nicht mehr zum Alltag gehört und natürliche Geburt kaum erlebt wird, nehmen Socialmediakanäle eine bedeutende Rolle zum Transport von Kulturformen ein. Während früher Sheela-na-Gigs die natürliche Geburt an Bauwerken in der Öffentlichkeit demonstrierten, werden heute Fotos aus Netzwerken entfernt und tabuisiert. Dieser kulturelle Eingriff kann zu starken Veränderungen führen in Hinblick auf das Familienleben und die Kultur, wie derzeit u.a. der Hebammenprotest in Bezug auf die Geburtskultur zeigt.
Den gesamten Vortrag könnt ihr Euch nun hier ansehen:
Der Abschied schmerzt immer – Warum 3 Monate keine namenlose Zeit sind

Eine Freundin von mir hat ihr Kind in der 8. Schwangerschaftswoche verloren*. Sie war noch „ganz am Anfang“, wie es heißt. Kaum jemandem hatte sie davon berichtet aus der Angst, dass doch etwas „schief gehen“ könnte. Es ging schief. Sie verlor ihr Kind. Doch wie geht man damit um, wenn man niemandem etwas davon gesagt hat? Wie kann man seinen Schmerz in Worte fassen gegenüber Menschen, die vorher nichts wussten? Und warum überhaupt ist es so, dass wir drei Monate niemandem etwas sagen von dem neuen Leben, das in uns wächst?
Ich stellte mir bei jedem meiner Kinder die Frage, wann ich Freunden und Verwandten von der Schwangerschaft berichten sollte. Ich kenne diese „magische Dreimonatsgrenze“, wie alle Schwangeren sie kennen. Letztlich war es jedoch so, dass ich es erzählte, sobald ich es wusste. Einfach deswegen, weil ich es nicht für mich behalten konnte vor Glück und auch, weil ich wusste, dass es keinen Sinn macht, es zu verbergen. Wenn ich Glück haben würde und die Schwangerschaft über die drei Monate hinaus gehen würde, würde ich es sowieso erzählen. Wäre dies nicht der Fall, würde ich Trost und Zuwendung benötigen von den Menschen in meiner Nähe. Und in einigen Fällen, so war ich mir sicher, würden auch sie trauern wollen um das, was ich hätte verlieren können.
Die ersten drei Monate einer Schwangerschaft – Zeit, in der nichts passiert?
Die ersten drei Monate einer Schwangerschaft sind eine besondere Zeit. In ihnen passiert sowohl körperlich als auch psychisch viel bei den werdenden Eltern, besonders der Mutter. Der Hormonhaushalt verändert sich, die Periode bleibt aus. Das Hormon Progesteron bewirkt, dass man häufiger auf die Toilette gehen muss. Die Hormone bewirken auch – zusammen mit dem gesteigerten Stoffwechsel und niedrigem Blutdruck – Müdigkeit und Schwindel. Der Magen ist empfindlicher, die Nase ebenfalls. Progesteron und Östrogen wirken entspannend und machen den Darm träge. Das Schwangerschaftshormon hCG verursacht die in der Schwangerschaft bekannte Übelkeit. In den ersten Monaten findet meistens noch keine oder nur eine geringe Gewichtszunahme statt, obwohl zum Beispiel die Gebärmutter eine große Leistung in Hinblick auf das Wachstum erbringt. Sichtbar wird die Schwangerschaft zum Ende des 3. Monats dann oft eher am Busen, weil dieser wächst und sich bereits jetzt auf die Stillzeit vorbereitet.
Und auch psychisch tut sich in diesen Monaten sehr viel: Freude, Überraschung, Unentschlossenheit, Kummer, Sorgen, Glück,… Es gibt viele Gefühle, die in den ersten Monaten wahrgenommen werden. Schwangere stellen sich viele Fragen von der Notwendigkeit einer Feindiagnostik bis hin zum möglichen Geschlecht des Kindes. Mutter werden jetzt schon oder jetzt noch? Kann ich das, will ich das? Wie verkraftet unsere Beziehung das? Werde ich vielleicht Alleinerziehend sein?
Sowohl durch die körperliche als auch durch die psychische Umstellung sind Frauen in den ersten Monaten der Schwangerschaft in einem besonderen Zustand, in dem sie gerade besonders viel Zuwendung brauchen. Gerade jetzt brauchen sie Gesprächspartner, um Sorgen und Glücksmomente zu teilen. Sie brauchen konkrete Bezugspersonen, bei denen sie auch Rat einholen können: Was kann man gegen Übelkeit unternehmen? Ist es normal, so oft auf Toilette zu müssen? Gerade die ersten drei Monate sind also keine Zeit, in der eigentlich ein Geheimnis aus der Schwangerschaft gemacht werden sollte.
Guter Hoffnung sein ist heute nicht mehr einfach
„Guter Hoffnung“ sein – das gilt eigentlich auch schon für diese Zeit. Aber wer traut sich das heute noch, einfach so voll von guter Hoffnung zu sein? „Guter Hoffnung“ zu sein bedeutet nämlich auch, nicht vom Schlimmsten auszugehen, sondern davon, dass es gut und normal verläuft. Ja, es gibt Fehlgeburten. Und diese sind besonders in den ersten Monaten vertreten, wenn das „Alles-oder-nichts-Prinzip“ herrscht. Das Risiko für eine Fehlgeburt hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Doch auch gerade über diese Ängste muss man sich austauschen können. „Guter Hoffnung“ zu sein, bedeutet, sich anderen anzuvertrauen und über den neuen Umstand sprechen zu können.
Vom richtigen Umgang mit einem frühen Abschied
Und wenn es doch passiert, der Verlust? Man ist nicht von heute auf morgen nicht mehr schwanger. Oft lassen die Schwangerschaftsanzeichen erst langsam nach. Auch wenn das Kind sich schon verabschiedet hat, braucht der Körper noch eine Weile, um das zu verstehen – und die Seele oft mindestens genauso lang, wenn nicht länger.
Wenn ein Kind geht, müssen wir uns verabschieden von Wünschen, Vorstellungen, Erwartungen. Mit dem positiven Schwangerschaftstest in der Hand wird eine Flut von Gedanken ausgelöst: Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Wie wird das Kind wohl aussehen? Wird es so gern malen wie ich oder mathematisch begabt wie der Vater? Was wird mit meinem Job, wie lange werde ich aussteigen? Wir machen uns Gedanken und es bilden sich Vorstellungen über eine Zukunft mit dem Kind. Vielleicht war die Schwangerschaft lange heiß ersehnt. Oder es gab schon zuvor Verluste. Gerade auch dann ist der Sturz vom Glückstaumel in die Trauer sehr groß. Doch wie auch immer die Ausgangslage war: Es gibt kein „trauriger sein“ als jemand anderes, der einen Verlust erlitten hat. Jeder Abschied ist schmerzhaft, ob es eine überraschende oder eine ersehnte Schwangerschaft war.
Und genau deswegen ist auch jeder Abschied es wert, betrauert zu werden. Ich habe schon oft von Frauen, die einen frühen Verlust in den ersten drei Monaten hatten, gehört, dass man in ihrem Umfeld erklärte, dass das ja noch kein richtiger Mensch gewesen sei, dass sie nicht traurig sein sollten oder dass sie froh sein sollten, dass der Verlust nicht später eingetreten ist, wenn es schon ein „richtiges Baby“ gewesen sei. Doch das ist nicht richtig. Das Kind nimmt nicht mit seiner Größe Gestalt in unseren Vorstellungen an, sondern mit seiner bloßen Existenz. Es gibt keinen geringeren Schmerz, nur weil das Kind erst wenige Millimeter groß ist. Ein Schmerz ist ein Schmerz.
Wer einen Verlust in der Schwangerschaft erleidet, hat jedes Recht darauf, zu trauern. Es ist gut, eine Hebamme an der Seite zu haben, die die Trauer begleiten kann. Es ist sehr wichtig, mit anderen Menschen über die Gefühle zu sprechen, die Trauer zu teilen, aufgefangen zu werden. Der Verlust eines Kindes ist ein Trauma. Zur normalen Bewältigung eines Traumas gehört es, mit nahen Menschen über das Erlebte zu sprechen. Oft muss mit mehreren Menschen wieder und wieder die Geschichte geteilt werden bis das Erlebte bewältigt ist und man es verarbeitet hat. Zahlreiche Internetforen und Blogs sind Beispiele dafür, wie wichtig es ist, sich mitzuteilen. Doch sie sind auch oft Beispiele dafür, wie wenig es im realen Leben, im Alltag, die Möglichkeit gibt, mit den Menschen der Umgebung über die Situation zu sprechen. Teils aus Scham, aus dem Gefühl, andere nicht belästigen zu wollen oder Freundschaften nicht zu überstrapazieren, wird dem Gespräch unter vier Augen aus dem Weg gegangen. Und zu einem großen Teil auch deswegen, weil man eben nicht weiß, wie man anfangen soll, wenn man den anderen noch nichts von seiner Schwangerschaft erzählt hat. Der Satz „Ich war schwanger…“ kommt nicht leicht über die Lippen.
Rituale können dabei helfen, einen Abschied in Worte oder in eine Handlung zu fassen. Gerade am Anfang, wenn man noch keine Kindsbewegungen gespürt hat, ist es manchmal schwer zu begreifen, dass das Baby nicht mehr da ist – man hatte ja schon kaum glauben können, dass es da war. Abschiede können auf sehr unterschiedliche Weise gestaltet werden. Es werden kleine Boote mit einer Kerze auf dem Wasser fahren gelassen, eine Skylaterne in die Luft geschickt oder es kann symbolisch etwas begraben werden.
Einen guten Blogartikel über die Erfahrungen einer Frau mit einem frühen Verlust in der Schwangerschaft habe ich hier gefunden.
Auch ein geplanter Abschied kann betrauert werden
Vor Jahren habe ich einmal eine Frau begleitet, die sich gegen die Schwangerschaft entschieden hatte. Es war ihre ganz persönliche Entscheidung – wie es immer eine ganz persönliche Entscheidung ist. Ich bewerte diese Entscheidungen nicht, denn es gibt keine Gründe, die wichtiger wären oder welche, die weniger wichtig sind. Man kann nicht sagen: „Also das ist nun wirklich ein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch.“ Oder „Das ist kein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch“. Oft bleiben die wahren Gründe für alle Menschen außerhalb der eigentlich Person sowieso im Unklaren. Wer sich dafür entscheidet, hat seinen ganz persönlichen Grund. Wie ich es aus meiner Arbeit kenne, sind diese Entscheidungen meistens keine einfachen. Man entscheidet nicht nebenher und über Nacht, dass man eine Schwangerschaft abbrechen möchte. Die Frau, die ich begleitete, entschied sich in den ersten 10 Wochen dafür, das Kind nicht austragen zu wollen. Sie war traurig, bestürzt, auch wütend. Sie hatte Angst. Und sie trauerte. Sie trauerte noch während sie das Kind in sich trug, dass sie sich von ihm verabschieden müssen würde. Sie war verunsichert, wie sie sich verabschieden könnte, denn sie hatte kaum Menschen in ihren Umstand eingeweiht. Für sie war wichtig zu wissen: Hebammenhilfte steht einer Schwangeren auch im Falle eines medizinischen Schwangerschaftsabbruchs zu. So können mit der Hebamme alle Dinge besprochen werden und man hat einen vertrauten Partner an der Seite. Darüber hinaus brauchte sie jedoch auch ein Ritual, um Abschied zu nehmen von dem Kind, das sie in sich trug. Sie schrieb einen Brief an sich und das Kind, faltete ihn zu einem Boot und ließ ihn fahren. Doch sie hat damit nicht ihre Gedanken fort geschickt. Sie ließ sich eine Träne tätowieren auf die Brust über das Herz. Für dieses Kind, das sie nicht austragen wollte. Auch wenn es in den ersten drei Monaten war, hat sie es nie vergessen. Denn auch sie zählen, diese ersten drei Monate. Man ist nicht erst ab dem vierten Monat schwanger.
* Mit ihrer Genehmigung schreibe ich diesen Beitrag über ein Thema, das auch sie sehr beschäftigt hat.
Merke Dir diesen Artikel auf Pinterest
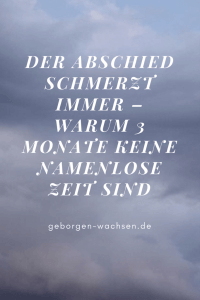
Die Online-Eltern – warum es nicht schlimm ist, einem Onlineclan anzugehören
Erst kürzlich kursierte u.a. auf Facebook wieder ein Artikel darüber, wie viel heutige Eltern am Smartphone hängen würden und welch schlimme Auswirkungen das auf die kindliche Entwicklung haben würde. In dem Artikel „Eltern ständig am Handy – Kinder werden depressiv“ wird betont, dass das Smartphone zu einem Konkurrent der Kinder geworden ist:
Denn für die Kleinen ist die Konkurrenz durch das Smartphone der absolute Horror. «Sie können dadurch sogar depressiv werden», warnt Grieder.
Neu ist diese These nicht, denn auch schon 2011 wird vor den „Unerreichbaren Müttern“ gewarnt. Und auch sonst hört oder liest man es oft: Eltern sind zu viel am PC oder Telefon und damit bei Twitter oder sonstwo. Dass Eltern heute viel Socialmediakanäle nutzen, ist klar. Die Fragen dazu lauten aber eigentlich: Warum machen sie das? Hilft es ihnen vielleicht gerade in ihrem Elternsein? Brauchen Kinder andauernde Aufmerksamkeit und ist das so vorgesehen?
Was Eltern brauchen sind andere Eltern
Beginnen wir also ganz am Anfang: Wir haben eine Mutter, die gerade zum ersten Mal Mutter geworden ist. Sie wohnt in einer schönen Stadt. Es ist nicht ihre Geburtsstadt, denn dort musste sie wegen ihres Jobs wegziehen. Ihre Eltern wohnen noch in der Geburtsstadt, ihre Geschwister sind – durch andere Jobs – in anderen Städten gelandet. Und selbst in dieser Stadt, in der sie nun wohnt, ist sie schon mehrfach umgezogen. Die Nachbarn kennt sie vom gelegentlichen Paketeabholen. Nun also ist sie Mutter. Sie hat zwar eine Hebamme und geht auch ab und zu zu einem Babykurs, aber dazwischen, da googelt sie nach Begriffen wie „Muttermilchstuhl“ oder „rote Pickel Hals Baby“. Sie ist eine von vielen, vielen Müttern.
Was Eltern ganz besonders brauchen in der Elternschaft sind eigentlich andere Eltern. Sie brauchen Austausch und Informationen. Sie müssen sehen, wie andere mit Babys umgehen und wie ein Baby gestillt wird, damit das auch beim eigenen klappt. Eltern brauchen andere Eltern. Würden wir mit anderen Familien eng zusammen leben (und zwar nicht durch dicke Mauern getrennt), würden wir sehen und hören, dass auch andere Babys (und Kinder) nicht durchschlafen. Wir würden sehen, was gemacht wird, wenn ein Baby Bauchweh hat und – das Beste – wir würden uns gegenseitig unterstützen und abwechseln. Dass wir vereinzelt leben in abgetrennten Wohnungen ist nämlich relativ neu in der Geschichte der Menschheit. Wir sind es nicht gewohnt, allein zu sein. Und wir sind es besonders nicht mit kleinen Kindern. Denn gerade dann brauchen wir andere. Wir brauchen Hilfe und Unterstützung.
Das Artgerecht-Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns an eben dies zu erinnern: „Allein mit Kindern sein – das ist weder für Erwachsene noch für Kinder artgerecht“. Bei Artgerecht-Treffen können Eltern Kontakte knüpfen, sich verbinden, einen Clan gründen. Das ist es, was wir eigentlich brauchen. Aber im Alltag ist das manchmal nicht so möglich. Vielleicht gibt es in der Nähe keine Artgerecht-Treffen oder es stehen eben doch noch viele andere Dinge auf dem Programm. Ganz allein sein, das können wir aber auch nicht. Wir brauchen den Austausch. Und natürlich liegt es nahe, dann die Kanäle zu nutzen, die man hat. So wird auf Twitter mitgeteilt, dass das Baby nicht schläft und man am Rande des Nervenzusammenbruchs ist. Man zeigt auf Instagramm Fotos vom Sprössling und tauscht sich in Gruppen auf Facebook darüber aus, welche Windeln man benutzen sollte oder was man von Durchschlaftipps hält. Eltern schaffen sich so eine Art medialen Clan. Sie sind in einer Gemeinschaft, die den Rücken stärkt, Hilfe bietet, tröstet, lobt, bestärkt. Sie hören von anderen Eltern in ganz Deutschland oder gar der ganzen Welt, dass Kinder überall nicht durchschlafen, lange gestillt werden und bei Mama und Papa mit im Bett schlafen wollen.
Natürlich ersetzt das Internet keine Freundschaften und auch nicht die Müttergruppe, mit der man nachmittags gemeinsam Kaffee trinkt. Aber es erweitert diese Möglichkeiten. Auch außerhalb eines Treffens oder eines Kurses wie FABEL, der Eltern in der Erziehungskompetenz stärkt und ihnen Informationen an die Hand gibt für den Alltag, haben Eltern die Möglichkeit zum Austausch. Und zwar rund um die Uhr. Wenn das Baby nachts um zwei eine Spielstunde veranstalten will, findet man auf Twitter ganz sicher Eltern, die aus irgendeinem Grund auch wach sind. Man ist nicht allein. Nie. Genau, wie es eigentlich für uns vorgesehen ist, denn – um es noch einmal zu wiederholen – wir sind soziale Wesen und ziehen Kinder eigentlich in Gemeinschaft auf.
Natürlich bedeutet das nicht, dass wir uns hinsetzen sollen und permanent in Anwesenheit der Kinder auf das Handy starren und tippen und auf Antworten warten sollen. Es ist wohl auch eher die Minderheit, die so vorgehen mag. Gut ist es natürlich, sowieso vorhandene Freizeiten für den Austausch im Netz zu wählen, etwa während des Nachmittags- oder Nachtschlafes. Aber natürlich darf man auch mal zwischendurch eine Nachricht versenden, etwas lesen oder telefonieren. Kompetenter Umgang ist gefragt. Und auch für die Kinder ist es gut, wenn Eltern den Ärger und Frust einmal nicht hinunter schlucken müssen, sondern anderen davon berichten können. Und natürlich ist es schön, auch mal von den Sonnenseiten des Elterndaseins vorzuschwärmen.
Eltern müssen nicht immer aufmerksam sein
Wie sollen Eltern denn nun eigentlich sein? Widmen sie ihren Kindern viel Aufmerksamkeit, werden sie gleich als Helikoptereltern beschimpft und durch die Presse gezogen. Machen sie es nicht, sind sie unempathische Soziopathen mit Smartphone. Es ist nicht einfach, Eltern zu sein. Man scheint sich permanent auf einem schmalen Grad zu bewegen. Doch schauen wir auch hier einmal, was die Natur vorgesehen hat: Sind Eltern wirklich diejenigen, die immer in der Nähe der Kinder saßen und jederzeit ansprechbar und mitteilsam waren? Das waren sie wohl kaum. Natürlicherweise gehen Eltern eben auch ihren Beschäftigungen nach. Sie arbeiten (idealerweise auf eine Art, die das Zusammensein mit den Kindern ermöglicht), sie kochen, waschen, putzen, unterhalten sich mit anderen. Sie sind eben nicht nur und ausschließlich auf die Kinder fokussiert. Leider hat sich unser Leben sehr gewandelt und wir arbeiten und leben nicht in Gemeinschaft und haben dadurch wenig Vorbilder. Und sicher ist es wichtig, in vielen Dingen auch einen Weg zurück zu finden und uns auf das Ursprüngliche wieder zu besinnen und für unser Leben zurück zu erobern. Doch unsere Fortschritte lassen sich nur schwer oder gar nicht rückgängig machen. Deswegen ist es gut, diese Neuerungen auf sinnvolle Weise zu nutzen und uns damit das nachzubilden, was wir brauchen. Kann man mitten in der Nacht keine Clanmitglieder persönlich fragen, was mit einem bei 40°C fiebernden Kind macht, tut man das auf Twitter oder Facebook. Das bedeutet nicht, dass man unaufmerksam ist, als Eltern versagt, weil man es nicht weiß. Es bedeutet nur, dass man sich Hilfe holt, wie es normal für uns ist.
Wie würden Eltern sein, die sich nur auf das Kind konzentrieren? Die allein mit Kind in der Wohnung sitzen und von morgens bis abends Kaufmannsladen und Mutter-Vater-Kind spielen würden? Wahrscheinlich ziemlich unglücklich. Und ja, man hat schließlich auch andere Dinge noch zu tun. Man muss den Haushalt, das Alltägliche erledigen und hat dabei auch nicht immer die Kinder im Auge.
Das ist auch gut. Denn Kinder brauchen auch Freiraum, um sich zu entwickeln. Sie müssen Möglichkeiten des Ausprobierens haben außerhalb des aufmerksamen elterlichen Blicks. Sie müssen auch Falsches tun und erfahren dürfen – unter dem permanenten Blick der Eltern ist das nicht möglich. Eltern müssen nicht 100 Prozent jederzeit bei ihren Kindern sein. Der 1886 geborene britische Kinderpsychoanalytiker Donald W. Winnicott entdeckte bereits, dass “zu gute Mütter” (too good mothers) keinesfalls das sind, was Kinder benötigen. Während das Baby am Anfang des Lebens mit seiner Mutter noch ganz verschmolzen und symbiotisch ist und Mütter bestenfalls prompt auf seine Bedürfnisse reagieren, brauchen Babys für ihre Entwicklung jedoch zunehmend auch ein gewisses Maß an Unzufriedenheit für ihre Entwicklung. Winnicott entdeckte, dass Mütter zunehmend weniger und weniger perfekt auf ihr Kind eingehen – und dies parallel zu den wachsenden Fähigkeiten des Kindes, damit umgehen zu können. Das bedeutet: Anfangs reagieren Mütter bestenfalls prompt und richtig auf das Baby. Mit der Zeit reagieren sie aber weniger schnell und lassen das Baby auch mal ein wenig quengeln, wenn es nicht an das Spielzeug heran kommt. Und dies hat eine ganz wichtige Bedeutung für die Entwicklung des Kindes: Es lernt nämlich dadurch, dass Bedürfnisse nicht sofort erfüllt werden müssen, sondern auch etwas aufgeschoben werden können. Hierdurch kann es auch lernen, sich selbst zu regulieren, weil es eigene Beruhigungsstrategien findet. Das Baby erfährt, wie man mit negativen Gefühlen umgehen kann. Auch kann es hierdurch zur weiteren Entwicklung angeregt werden: Wer sofort alles gereicht bekommt, wenn er etwas quengelt ist nicht darauf angewiesen, sich selbst zu bewegen. Ein gewisses Maß an Unzufriedenheit ist also durchaus als Motor der Entwicklung zu betrachten. Umgekehrt wird einem Baby, dem jeder Wunsch schon von vornherein “von den Augen abgelesen wird”, um die Fähigkeit gebracht, sich selbst zu verstehen. Es lernt keine Selbstwirksamkeit, weil es nicht erfahren kann, dass es sich auch selbst helfen kann und darf. Winnicott findet daher, dass die “good enough mother” der “too good mother” gegenüber vorzuziehen ist. Wir müssen also nicht Supereltern sein, sondern einfach nur hinreichend gut!
Kinder brauchen andere Kinder
Natürlich bedeutet all dies nicht, dass Eltern nur noch Onlineaustausch benötigen und es kein Problem ist, wenn sie ständig auf das Handy schielen. Selbstverständlich kommt es auf das richtige Maß an. Aber wir brauchen auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir unseren Alltag online teilen. Wir müssen uns nicht ständig nur und ausschließlich auf die Familie konzentrieren. Wir dürfen uns austauschen, Rat und Unterstützung holen. Es ist normal. Und es hilft in so vielen Momenten.
Was wir dennoch nicht vergessen dürfen: Auch Kinder brauchen Gemeinschaft und Austausch. Sie brauchen konkrete, wirklich anwesende Personen zum Spiel, zur Auseinandersetzung, zum Lernen. Sie brauchen einen real vorhandenen Clan und Erfahrungen außerhalb der eigenen vier Wände. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns nicht nur online austauschen und einigeln, auch wenn wir dort jederzeit Antworten und Gemeinschaft finden können. Was für uns vielleicht eine gute Alternative ist bei mangelnden realen Kontakten, ist es für die Kinder nicht. Für sie müssen wir auch außerhalb von Twitter und Facebook Gruppen finden und Gleichgesinnte. Für sie und mit ihnen besuchen wir Babykurse und Krabbelgruppen und suchen auf Spielplätzen und in Turngruppen Menschen, die zu uns passen und mit denen wir auch im realen Leben ein Netzwerk aufbauen können. Aber wenn wir das haben, wenn wir gut eingebunden sind, dann spricht nichts dagegen, dass wir auch mal das Handy zücken und dort Gemeinschaft suchen und haben.
Mädchen sein, Frau sein – mit einem guten Körperbild

In den letzten Monaten bin ich immer wieder auf Artikel gestoßen zum Thema Geschlechtsidentität entwickeln, Entwicklung von Mädchen, Frau werden, die mir gezeigt haben, dass es momentan ein wirklich wichtiges Thema ist. Auch unter den Mütter-Bloggerinnen ist es längst ein Thema. @dasnuf schrieb im September über „Neuigkeiten aus dem frisch duftenden Freudental“ und der Feststellung, dass aufwachsende Mädchen und Frauen heute durch Pflegeprodukte in den Glauben versetzt werden, dass der weibliche Genitalbereich grundsätzlich stinken würde und man mit diversen „wohlriechenden“ Pflegeprodukten Abhilfe schaffen müsste. @berlinmittemom Anna Luz de León beschäftigt sich derzeit in einer Artikelreihe damit, dass Studien zum Ergebnis kamen, dass „in Deutschland 64 Prozent aller Mädchen im Teenageralter aufhören, die Dinge zu tun, die sie lieben, weil sie sich mit ihrem Äußeren unwohl fühlen“. Und dann gibt es auch noch Werbespots, die zwar erst einmal offensiv mit Weiblichkeit umgehen und Mädchen eine Art des freudvollen Umgangs mit der Menstruation beizubringen scheinen, dann aber doch nur die „heimliche“ Zustellung eines Menstruationssets bewerben: „It’s like christmas for your vagina!“ Zu solchen Anbietern zählt auch „Madame Ladybug„, wo man sich – je nach Bedarf preislich gestaffelt – eines von drei Menstruationspaketen monatlich zusenden lassen kann. Die beiden teureren Pakete enthalten auch gleich das Schmerzmittel „Midol“ neben Tee und Snacks. Welches Bild erhalten Mädchen also vom Frausein? Und was sollten wir anders tun?
Es fängt – wie immer – am Anfang an. Ich möchte hier in diesem Rahmen nicht auf die Sex-Gender-Debatte und auf rosa Mädchensachen, Barbie und Co. eingehen. Hier soll es nur um das Körpergefühl gehen, das wir unseren Kindern vermitteln. Und das vermitteln wir von Anfang an. Es beginnt damit, wie wir Geschlechtsorgane bezeichnen, bzw. ob wir ihnen überhaupt einen Namen geben. Denn oft genug höre ich auch heute noch die Bezeichnung „untenrum“, wenn sich irgendwas auf die primären Geschlechtsorgane bezieht. Doch natürlich brauchen Körpergliedmaßen einen Namen, denn wie sollen sie namenlos für ein Kind real existieren? Was keinen Namen hat, darüber spricht man nicht. Doch gerade Kinder müssen über ihr Geschlecht und ihre Geschlechtsorgane sprechen.
Schon Babys brauchen den Raum, um sich mit sich selbst vertraut zu machen – Mädchen und Jungs gleichermaßen. Im Nacktsein dürfen sie ihren ganzen Körper erfahren. Für die Entwicklung des Körpergefühls ist es wichtig, dass der gesamte Körper selbst erkundet werden darf. Heute, wo viele Babys in unserer Kultur die meiste Zeit des Tages in einer verschlossenen Windel verbringen, sind gerade auch die Wickelsituationen besonders bedeutsam. Was vermitteln wir einem Kind, wenn wir angeekelt in die volle Windel blicken und mit schnellen, unsanften Bewegungen den Windelinhalt beseitigen? Wenn wir uns entscheiden, mit Windeln zu wickeln und das Kind nicht abzuhalten (windelfrei zu praktizieren), ist dies unsere Entscheidung und nicht die des Kindes. Und so müssen wir auch unsere eigene Konsequenz daraus ziehen. In diesem Fall bedeutet es, dass natürlich nicht das Kind in irgendeiner Weise negativ zu behandeln ist, weil es die Windel voll gemacht hat. Im Gegenteil: Das Windeln wechseln sollte ein Moment der Ruhe sein können, in dem das Baby beteiligt werden kann, in dem man ihm Ruhe lässt. Je nach Alter darf es auch an der Wickelsituation beteiligt werden. Vielleicht kann es einfach schon selbst ein Papiertuch halten oder nach dem ersten Säubern durch Mutter oder Vater kann das Kind selbst noch einmal nachwischen. Sprache ist auch hier wichtig: Das Wickeln ist ein wunderbarer Moment, um miteinander zu reden, in den Austausch zu kommen. Der Wickelnde kann beschreiben, was er tut. Er kann Empfindungen des Babys umschreiben: Der Waschlappen fühlt sich nass an, oder? Je mobiler das Baby wird, desto weniger einfach sind diese Wickelsituationen ruhig zu gestalten, weil das Kind vielleicht lieber krabbeln oder laufen möchte. Doch wenn man dem Kind von Anfang an die Möglichkeit gibt, selbst beteiligt zu sein, ist das Wickeln oftmals einfacher und ganz nebenbei erfährt das Baby Wertschätzung für den Windelbereich.
Und noch etwas anderes ist wichtig, wenn es darum geht, ein gesundes Körperbild von Anfang zu entwickeln: Andere Menschen sehen. Und zwar nicht nur die halbnackten „Schönheiten“ auf den Werbeplakaten. Mit meiner Tochter bin ich schon oft am Kindertag im Hamam gewesen. Dort unter Frauen kann sie sich ein eigenes Bild machen von der Vielfältigkeit des Frauseins. Ich erinnere mich noch an die Situation, als wir einmal dort waren und sie mich fragte: „Mama, warum hat die Frau so verschrumpelte Brüste?“ Es war eine alte Frau und im ersten Moment war mir die Situation unangenehm, denn ich war mir ziemlich sicher, dass die Frau sie gehört hatte. Doch dann sagte ich ihr einfach, dass die Frau eben schon viel älter sei und das normal wäre und fand es auf einmal ganz großartig, dass meine Tochter an diesem Ort so viele verschiedene Frauen sehen konnte: jung und alt, dick und dünn, verschiedenen kulturellen Ursprungs und doch alle gemeinsam an diesem Ort, an dem sie sich der Körperpflege hingeben. Jede auf ihre Art mit ihrem Körper.
Körperlichkeit hat von Anfang an auch mit den Worten zu tun, die wir nutzen. Wie beschreiben wir unser Kind? Necken wir es, indem wir ihm Unzulänglichkeiten vor die Nase halten? Ich erinnere mich noch heute daran, wie unangenehm es mir war, dass mich meine Tante sicher die ersten 10 Lebensjahre immer „Pummelchen“ nannte. Selbst, wenn wir es als Liebkosung meinen, hinterlassen solche Worte Spuren in uns. Deswegen sollten wir den Körper unserer Kinder mit dem Respekt behandeln, den wir uns selbst wünschen. Nicht nur mit Respekt im manuellen Umgang, sondern auch mit sprachlichem Respekt. Kinder sollten nicht als dick, pummelig, steif oder sonstwas bezeichnet werden. Sie sind, wie sie sind. Und sie sind immer aus gutem Grund so, wie sie sind.
Ganz selbstverständlich gehört zum positiven Körpergefühl auch, dass das Kind keine negativen Körpererfahrungen machen muss, d.h. dass es nicht geschlagen oder anderweitig misshandelt oder missbraucht wird. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für viele Eltern, aber leider zeigen Studien immer wieder, wie viele Kinder missbraucht und/oder misshandelt werden, was natürlich schwerwiegende Folgen für die Entwicklung des Körpergefühls hat. Kinder haben Rechte. Und eines davon ist das Recht auf gewaltfreie Erziehung.
Dies alles sind nur die Vorbereitungen, die wir treffen können: Kinder ihren Körper selbst erfahren lassen, ihre Geschlechtsteile benennen, respektvoll mit ihrem Körper umgehen – sowohl verbal als auch im alltäglichen Umgang. Dazu sind wir selbst natürlich wichtige Vorbilder und beeinflussen, wie sie ihren Körper betrachten. Sagen wir, dass wir uns hässlich fühlen, dass wir zu viel wiegen würden oder mäkeln hier und da an unserem Aussehen vor den Kindern herum? Unsere Kinder finden uns schön. Viele, viele Jahre lang. Wenn wir ihnen vorleben, dass wir uns selbst schön finden und zufrieden sind mit uns, dann ist das ein sehr guter Grundstein dafür, dass auch sie sich in ihrer Haut wohl fühlen.
Was Mädchen betrifft, hat auch der Umgang mit der Menstruation großen Vorbildcharakter: Zeigen wir unserer Tochter monatlich, wie schlimm, schmerzhaft, unangenehm, eklig die Menstruation ist? Oder können wir es – wenigstens ein kleines Stück – als Fest der Weiblichkeit feiern? Mein eigener Eintritt in das Frausein war vor 20 Jahren nicht so, wie ich es mir für meine Tochter wünschen würde. Umso mehr habe ich eine Vorstellung davon, wie ich mit ihr diesen Tag begehen möchte: Eine Feier soll es sein zwischen Mutter und Tochter, in der ich sie in einen neuen Lebensabschnitt aufnehme. Ein Fest für uns, an dem wir es uns gut gehen lassen. An dem wir ganz Frau sind. In früheren Zeiten gab es Zeremonien, die extra für diesen Übergang zelebriert wurden. Leider sind uns solche heute verloren gegangen. Einer Tradition zufolge wird der jungen Frau zur ersten Menstruation ein roter Stein geschenkt. Für meine Tochter habe ich den Ring mit rotem Stein schon hier. Er ist noch von meiner Großmutter. Ich hoffe, ich werde ihn einer selbstbewussten jungen Frau an den Finger stecken, die sich in ihrem Körper wohl fühlt und einfach glücklich ist. So, wie sie ist.
Wie heißt das Zauberwort? Respekt.
„Danke“ sage ich zu meinem kleinen Kind als es mir den Baustein überreicht. Mit einem „Bitte“ stelle ich das Getränk vor ihm ab. „Bitte“ und „Danke“ sind Begleiter im Alltag mit Kindern. Und dennoch sind es keine Wörter, die abverlangt werden können oder sollten, denn mit einem „Und wie heißt das Zauberwort?“ werden wir unserem Kind nicht das Empfinden von Dankbarkeit vermitteln. Dankbarkeit ist ein Gefühl, das empfunden werden sollte, es ist keine lehre Worthülse. Und genau dies können wir unseren Kindern beibringen, indem wir nicht Worte erzwingen, sondern Bestandteil des Alltags sein lassen.
Weiterlesen
„Ist doch nicht so schlimm!“ Ist es doch. – Über das Trösten
Kinder sind oft erstaunlich robust: Sie lernen zu krabbeln, sich hin zu setzen und zu laufen. Und dabei machen sie immer wieder auch unsanfte Erfahrungen. Sie stürzen, sie holen sich blaue Flecken und Schürfwunden. Und all diese Erfahrungen sind leider auch wichtig, denn das Baby und Kleinkind muss lernen, wie es sich richtig bewegt, wie es richtig vom Stehen zum Sitzen kommt und es muss auch lernen, wie es sich beim Fallen gut abrollen kann, um schlimme Verletzungen später zu vermeiden.
Genauso wie das Kind jedoch diese Erfahrungen benötigt, braucht es in solchen Situationen auch eine andere Erkenntnis: Es ist jemand da, der mich wahrnimmt, der meine Gefühle spiegelt, ihnen überhaupt erst Worte gibt, und mir dadurch auch ein Bild über mich selbst vermittelt. Der mir vermittelt: „Ich sehe deinen Schmerz oder dein Erschrecken. Es ist berechtigt, wie du fühlst. Du fühlst! Ich bin für dich da. Es wird wieder gut.“
Wie sich das Fühlen entwickelt
Wenn ein Baby auf die Welt kommt, weiß es anfangs all die unterschiedlichen Gefühle noch nicht zu deuten. Hunger, Durst, Unwohlsein durch eine volle Windel, Angst, Freude, Glück… Es gibt so vieles zu lernen und zu entdecken. Das Baby lernt in den ersten Lebensjahren, all diese unterschiedlichen Empfindungen kennen und deuten. Dafür braucht es aber ein Gegenüber, das ihm all das verständlich erklärt. Die Bindungsperson nimmt die Signale des Babys wahr, deutet sie und erklärt sie: „Oh, da hat wohl nun jemand Hunger.“ oder „Du brauchst wohl eine neue Windel.“ Der Psychoanalytiker und Hirnforscher Allan N. Schore bezeichnet die Rolle der Mutter (wir können dies aber auch auf andere nahe Bezugspersonen übertragen) im ersten Lebensjahr deswegen auch als „Hilfskortex des Babys“ – sie ist das Großhirn des Kindes, das ihm die Welt erklärt. Erst mit 3 Jahren kann das Baby die Emotionen anderer gut verstehen, sich in sie recht gut hinein versetzen und auch seine eigenen Gefühle besser steuern. Das kann es aber nur dann, wenn es vorher von der Bindungsperson gelernt hat, wie das geht.
Kinder lernen durch feinfühliges Spiegeln
Wir alle kennen auch ähnliche Situationen: Das Kind tut sich weh, es weint, wir nehmen es in den Arm und sagen: „Oh, du hast dir weh getan. Ja, das tut weh.“ vielleicht auch „Oh nein, der Stuhl steht ja ganz ungünstig, so dass du dich daran gestoßen hast.“. Es wird versprachlicht, was passiert ist. Unsere Stimme ist ein Singsang, auch wenn die Augen aufgerissen sind. Wir mildern das Geschehen ab, beruhigen so das Kind. Dabei bleibt jedoch die Botschaft erhalten und auch, dass wir Gefühle in Worte verpacken. Denn nur so kann das Kind auch lernen, dass man Gefühle versprachlichen kann. Eine wichtige Eigenschaft für das ganze Leben. Wer wegschaut und die Verletzung nicht wahrnimmt oder gar negiert mit einem „Hat ja nicht weh getan!“, nimmt dem Kind auch die Möglichkeit, die Fähigkeit zu entwickeln, selbst darüber zu sprechen. Das Kind kann keine richtige Wahrnehmung von sich selbst entwickeln und verhält sich nicht so, wie es eigentlich sollte, da es sich nicht richtig selbst fühlen kann. Vielmehr verhält es sich so, wie es gelernt hat, sich zu verhalten. Diese andere Selbstwahrnehmung und das Fehlen der Wahrnehmung der wirklichen Gefühle und Bedürfnisse kann sich das Leben lang forttragen und langfristig Folgen nach sich ziehen.
Warum Zuwendung wirklich gegen Schmerzen hilft
Wir wissen es doch eigentlich selbst: Wenn es uns nicht gut geht, hilft es oft, von einem Menschen in den Arm genommen zu werden. Es ist nicht nur das Gefühl, dass jemand da ist für uns, sondern die Berührung löst auch wirklich etwas in unserem Körper aus. Durch respektvolle (!) Berührungen werden im Gehirn Rezeptoren stimuliert, wodurch Stresshormone abgebaut werden können. Sogar liebevoller Blickkontakt löst bereits eine solche Reaktion aus. Fehlt die liebevolle Zuwendung aber längerfristig, entwickeln Kinder sogar weniger Rezeptoren, d.h. sie können sich generell schwieriger beruhigen. Sind Kinder gestresst oder ängstlich, können sie weniger gut neue Informationen aufnehmen: das Lernen ist erschwert.
Natürlich gibt es auch Situationen, in denen Kinder sich verletzten und scheinbar keinen Schmerz fühlen. Sie stehen auf und rennen weiter. Auch das ist in Ordnung. Wir müssen Kinder nicht dazu anhalten, sich verletzt zu fühlen. Aber wir sollten ihnen dann, wenn sie Zuwendung und Trost brauchen, den Raum dafür geben. Wir können Fragen: „Hast Du dich verletzt, brauchst du Hilfe?“ und die Antwort des Kindes so annehmen, wie das Kind sie formuliert.
Tröstbarkeit ist unterschiedlich
Kinder unterscheiden sich in so vielen einzelnen Punkten: Im Tempo ihrer Entwicklung, in ihrem Aussehen, aber auch in den vielen kleinen Dingen, denen wir kaum Aufmerksamkeit schenken in unserem Alltag und von denen wir oft pauschalisierende Aussagen machen wie „Alle Babys beruhigen sich schnell, wenn sie auf den Arm genommen werden.“ Tatsächlich aber ist die Tröstbarkeit eines Babys genauso individuell wie die beispielsweise die Erregbarkeit: Was einige Babys geduldig wegstecken, führt bei anderen schnell zu starkem Weinen. Einige Kinder möchten getragen und gewiegt werden, andere werden gerne mit Körperkontakt und Geräuschen getröstet. Als Eltern müssen wir herausfinden, was unser Kind braucht, was ihm hilft.
Warum wir es so schwer haben, liebevoll mit Kindern umzugehen
All diese Informationen zeigen, dass es sehr sinnvoll ist, wenn Kinder liebevoll begleitet werden. Wenn wir ihnen nicht sagen, dass „sie sich nicht anstellen sollen“ oder „Jungs weinen nicht!“ oder wir gar behaupten „Tut doch gar nicht weh.“. Stürze und Verletzungen erschrecken oft oder tun weh und wir müssen dies aufnehmen, für das Kind übersetzen und trösten. Und doch tun wir uns besonders hierzulande so schwer damit, Kinder zu trösten. Immer wieder gibt es den Vorwurf, man würde sein Kind verziehen oder verweichlichen, wenn man es oft in den Arm nimmt und auch bei „Kleinigkeiten“ tröstet.
Leider ist dieser Umgang mit dem Kind noch immer unserem geschichtlichen Erbe geschuldet. Wenn wir vom Verwöhnen sprechen, vom Lob der Disziplin, von Gehorsam und Abhärtung, dann sind das alles Begriffe, die die Erziehung und Denkansätze vergangener Jahrzehnte wiederholen.
Es wundert also nicht, wenn wir auf andere Eltern stoßen, die von ihren Kindern das Nicht-Weinen verlangen. Vielleicht wissen sie es nicht besser. Wahrscheinlich sind sie selbst mit diesen Argumenten aufgewachsen, die sich in ihren Köpfen hartnäckig festgesetzt haben. Sicher ist aber, dass es an uns liegt, dieses Denken und diese Tradition endlich zu beenden. Nehmt also Eure Kinder in den Arm, tröstet sie und lasst sie Kinder sein – so, wie Ihr es Euch als Kind ganz sicher auch gewünscht hättet.
Eure
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und kindliche Entwicklung. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de
Weiterführende Literatur:
Mierau, Susanne (2019): Mutter.Sein. Von der Last eines Ideals und dem Glück des eigenen Wegs. – Weinheim: Beltz.
Mierau, Ssuanne (2016): Geborgen wachsen. Wie Kinder glücklich groß werden. München: Kösel.
Mierau, Susanne (2017): Geborgene Kindheit. Kinder liebevoll und entspannt begleiten. München: Kösel.
Brisch, Karl Heinz (2010): SAFE. Sichere Ausbildung für Eltern. – Stuttgart: Klett-Cotta.
Ustorf, Anne-Ev (2012): Allererste Liebe: Wie Babys Glück und Gesundheit lernen. – Stuttgart: Klett-Cotta.
Co-Sleeping stärkt die Bindung
… nicht nur zwischen Eltern und Kind, sondern auch zwischen den Geschwistern
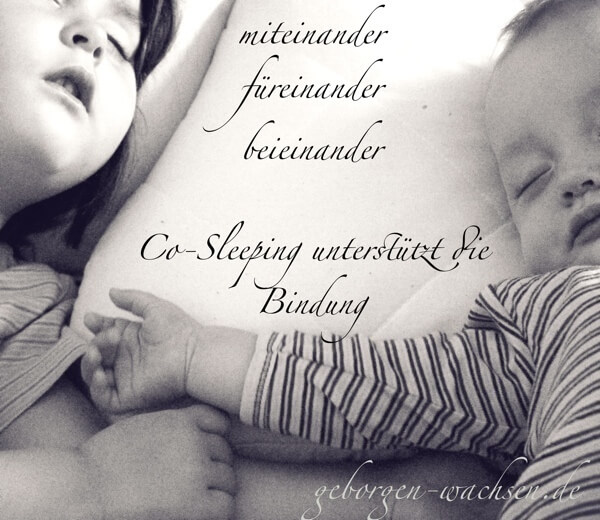
Attachment Parenting verstehen
Man liest es in Elternzeitschriften und hört in Krabbelgruppen davon: Attachment Parenting ist in aller Munde. Doch was genau bedeutet eigentlich dieses Konzept, das da aus Amerika scheinbar zu uns herüber gekommen ist? Ist es wirklich ein strenges Konzept mit Regeln, an die man sich irgendwie halten muss?
„Was wir taten, taten wir, weil es uns natürlich erschien. Erst später fanden wir heraus, dass es einen Namen dafür gab, der das, was wir taten, im Nachhinein bestätigte.“
– W. & M. Sears 2012, S. 17
Dieses Zitat beschreibt eigentlich schon, um was es bei Attachment Parenting geht: um natürliches und vom ureigenen Instinkt gelenktes Eltern-Kind-Verhalten.
„Stillen macht die Brüste schlaff“ – Dieses und weitere Ammenmärchen über das Stillen
Stillen ist die normale und gesunde Ernährung des Babys. Auch wenn oftmals von „Vorteilen“ des Stillens gesprochen wird, ist dies nicht ganz richtig: Denn stillen ist einfach normal und gesund und muss deswegen nicht mit seinen positiven Begleitfaktoren hervor gehoben werden. Wie groß auch die Bemühungen der Hersteller künstlicher Säuglingsnahrung sein mögen, sich am Vorbild der Natur zu orientieren, ist dies einfach nicht möglich, da in der Muttermilch Inhaltsstoffe vertreten sind, die sich einfach auf künstlichem Wege nicht herstellen lassen. Muttermilch ist und bleibt daher das natürliche und gesündeste Lebensmittel für Babys. Dennoch gibt es Ammenmärchen über das Stillen, die sich hartnäckig halten. An dieser Stelle soll einmal mit den häufigsten von ihnen aufgeräumt werden: