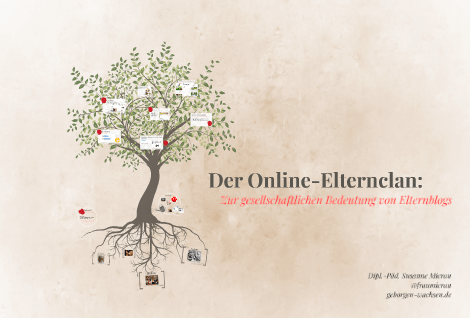Erst kürzlich kursierte u.a. auf Facebook wieder ein Artikel darüber, wie viel heutige Eltern am Smartphone hängen würden und welch schlimme Auswirkungen das auf die kindliche Entwicklung haben würde. In dem Artikel „Eltern ständig am Handy – Kinder werden depressiv“ wird betont, dass das Smartphone zu einem Konkurrent der Kinder geworden ist:
Denn für die Kleinen ist die Konkurrenz durch das Smartphone der absolute Horror. «Sie können dadurch sogar depressiv werden», warnt Grieder.
Neu ist diese These nicht, denn auch schon 2011 wird vor den „Unerreichbaren Müttern“ gewarnt. Und auch sonst hört oder liest man es oft: Eltern sind zu viel am PC oder Telefon und damit bei Twitter oder sonstwo. Dass Eltern heute viel Socialmediakanäle nutzen, ist klar. Die Fragen dazu lauten aber eigentlich: Warum machen sie das? Hilft es ihnen vielleicht gerade in ihrem Elternsein? Brauchen Kinder andauernde Aufmerksamkeit und ist das so vorgesehen?
Was Eltern brauchen sind andere Eltern
Beginnen wir also ganz am Anfang: Wir haben eine Mutter, die gerade zum ersten Mal Mutter geworden ist. Sie wohnt in einer schönen Stadt. Es ist nicht ihre Geburtsstadt, denn dort musste sie wegen ihres Jobs wegziehen. Ihre Eltern wohnen noch in der Geburtsstadt, ihre Geschwister sind – durch andere Jobs – in anderen Städten gelandet. Und selbst in dieser Stadt, in der sie nun wohnt, ist sie schon mehrfach umgezogen. Die Nachbarn kennt sie vom gelegentlichen Paketeabholen. Nun also ist sie Mutter. Sie hat zwar eine Hebamme und geht auch ab und zu zu einem Babykurs, aber dazwischen, da googelt sie nach Begriffen wie „Muttermilchstuhl“ oder „rote Pickel Hals Baby“. Sie ist eine von vielen, vielen Müttern.
Was Eltern ganz besonders brauchen in der Elternschaft sind eigentlich andere Eltern. Sie brauchen Austausch und Informationen. Sie müssen sehen, wie andere mit Babys umgehen und wie ein Baby gestillt wird, damit das auch beim eigenen klappt. Eltern brauchen andere Eltern. Würden wir mit anderen Familien eng zusammen leben (und zwar nicht durch dicke Mauern getrennt), würden wir sehen und hören, dass auch andere Babys (und Kinder) nicht durchschlafen. Wir würden sehen, was gemacht wird, wenn ein Baby Bauchweh hat und – das Beste – wir würden uns gegenseitig unterstützen und abwechseln. Dass wir vereinzelt leben in abgetrennten Wohnungen ist nämlich relativ neu in der Geschichte der Menschheit. Wir sind es nicht gewohnt, allein zu sein. Und wir sind es besonders nicht mit kleinen Kindern. Denn gerade dann brauchen wir andere. Wir brauchen Hilfe und Unterstützung.
Das Artgerecht-Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns an eben dies zu erinnern: „Allein mit Kindern sein – das ist weder für Erwachsene noch für Kinder artgerecht“. Bei Artgerecht-Treffen können Eltern Kontakte knüpfen, sich verbinden, einen Clan gründen. Das ist es, was wir eigentlich brauchen. Aber im Alltag ist das manchmal nicht so möglich. Vielleicht gibt es in der Nähe keine Artgerecht-Treffen oder es stehen eben doch noch viele andere Dinge auf dem Programm. Ganz allein sein, das können wir aber auch nicht. Wir brauchen den Austausch. Und natürlich liegt es nahe, dann die Kanäle zu nutzen, die man hat. So wird auf Twitter mitgeteilt, dass das Baby nicht schläft und man am Rande des Nervenzusammenbruchs ist. Man zeigt auf Instagramm Fotos vom Sprössling und tauscht sich in Gruppen auf Facebook darüber aus, welche Windeln man benutzen sollte oder was man von Durchschlaftipps hält. Eltern schaffen sich so eine Art medialen Clan. Sie sind in einer Gemeinschaft, die den Rücken stärkt, Hilfe bietet, tröstet, lobt, bestärkt. Sie hören von anderen Eltern in ganz Deutschland oder gar der ganzen Welt, dass Kinder überall nicht durchschlafen, lange gestillt werden und bei Mama und Papa mit im Bett schlafen wollen.
Natürlich ersetzt das Internet keine Freundschaften und auch nicht die Müttergruppe, mit der man nachmittags gemeinsam Kaffee trinkt. Aber es erweitert diese Möglichkeiten. Auch außerhalb eines Treffens oder eines Kurses wie FABEL, der Eltern in der Erziehungskompetenz stärkt und ihnen Informationen an die Hand gibt für den Alltag, haben Eltern die Möglichkeit zum Austausch. Und zwar rund um die Uhr. Wenn das Baby nachts um zwei eine Spielstunde veranstalten will, findet man auf Twitter ganz sicher Eltern, die aus irgendeinem Grund auch wach sind. Man ist nicht allein. Nie. Genau, wie es eigentlich für uns vorgesehen ist, denn – um es noch einmal zu wiederholen – wir sind soziale Wesen und ziehen Kinder eigentlich in Gemeinschaft auf.
Natürlich bedeutet das nicht, dass wir uns hinsetzen sollen und permanent in Anwesenheit der Kinder auf das Handy starren und tippen und auf Antworten warten sollen. Es ist wohl auch eher die Minderheit, die so vorgehen mag. Gut ist es natürlich, sowieso vorhandene Freizeiten für den Austausch im Netz zu wählen, etwa während des Nachmittags- oder Nachtschlafes. Aber natürlich darf man auch mal zwischendurch eine Nachricht versenden, etwas lesen oder telefonieren. Kompetenter Umgang ist gefragt. Und auch für die Kinder ist es gut, wenn Eltern den Ärger und Frust einmal nicht hinunter schlucken müssen, sondern anderen davon berichten können. Und natürlich ist es schön, auch mal von den Sonnenseiten des Elterndaseins vorzuschwärmen.
Eltern müssen nicht immer aufmerksam sein
Wie sollen Eltern denn nun eigentlich sein? Widmen sie ihren Kindern viel Aufmerksamkeit, werden sie gleich als Helikoptereltern beschimpft und durch die Presse gezogen. Machen sie es nicht, sind sie unempathische Soziopathen mit Smartphone. Es ist nicht einfach, Eltern zu sein. Man scheint sich permanent auf einem schmalen Grad zu bewegen. Doch schauen wir auch hier einmal, was die Natur vorgesehen hat: Sind Eltern wirklich diejenigen, die immer in der Nähe der Kinder saßen und jederzeit ansprechbar und mitteilsam waren? Das waren sie wohl kaum. Natürlicherweise gehen Eltern eben auch ihren Beschäftigungen nach. Sie arbeiten (idealerweise auf eine Art, die das Zusammensein mit den Kindern ermöglicht), sie kochen, waschen, putzen, unterhalten sich mit anderen. Sie sind eben nicht nur und ausschließlich auf die Kinder fokussiert. Leider hat sich unser Leben sehr gewandelt und wir arbeiten und leben nicht in Gemeinschaft und haben dadurch wenig Vorbilder. Und sicher ist es wichtig, in vielen Dingen auch einen Weg zurück zu finden und uns auf das Ursprüngliche wieder zu besinnen und für unser Leben zurück zu erobern. Doch unsere Fortschritte lassen sich nur schwer oder gar nicht rückgängig machen. Deswegen ist es gut, diese Neuerungen auf sinnvolle Weise zu nutzen und uns damit das nachzubilden, was wir brauchen. Kann man mitten in der Nacht keine Clanmitglieder persönlich fragen, was mit einem bei 40°C fiebernden Kind macht, tut man das auf Twitter oder Facebook. Das bedeutet nicht, dass man unaufmerksam ist, als Eltern versagt, weil man es nicht weiß. Es bedeutet nur, dass man sich Hilfe holt, wie es normal für uns ist.
Wie würden Eltern sein, die sich nur auf das Kind konzentrieren? Die allein mit Kind in der Wohnung sitzen und von morgens bis abends Kaufmannsladen und Mutter-Vater-Kind spielen würden? Wahrscheinlich ziemlich unglücklich. Und ja, man hat schließlich auch andere Dinge noch zu tun. Man muss den Haushalt, das Alltägliche erledigen und hat dabei auch nicht immer die Kinder im Auge.
Das ist auch gut. Denn Kinder brauchen auch Freiraum, um sich zu entwickeln. Sie müssen Möglichkeiten des Ausprobierens haben außerhalb des aufmerksamen elterlichen Blicks. Sie müssen auch Falsches tun und erfahren dürfen – unter dem permanenten Blick der Eltern ist das nicht möglich. Eltern müssen nicht 100 Prozent jederzeit bei ihren Kindern sein. Der 1886 geborene britische Kinderpsychoanalytiker Donald W. Winnicott entdeckte bereits, dass “zu gute Mütter” (too good mothers) keinesfalls das sind, was Kinder benötigen. Während das Baby am Anfang des Lebens mit seiner Mutter noch ganz verschmolzen und symbiotisch ist und Mütter bestenfalls prompt auf seine Bedürfnisse reagieren, brauchen Babys für ihre Entwicklung jedoch zunehmend auch ein gewisses Maß an Unzufriedenheit für ihre Entwicklung. Winnicott entdeckte, dass Mütter zunehmend weniger und weniger perfekt auf ihr Kind eingehen – und dies parallel zu den wachsenden Fähigkeiten des Kindes, damit umgehen zu können. Das bedeutet: Anfangs reagieren Mütter bestenfalls prompt und richtig auf das Baby. Mit der Zeit reagieren sie aber weniger schnell und lassen das Baby auch mal ein wenig quengeln, wenn es nicht an das Spielzeug heran kommt. Und dies hat eine ganz wichtige Bedeutung für die Entwicklung des Kindes: Es lernt nämlich dadurch, dass Bedürfnisse nicht sofort erfüllt werden müssen, sondern auch etwas aufgeschoben werden können. Hierdurch kann es auch lernen, sich selbst zu regulieren, weil es eigene Beruhigungsstrategien findet. Das Baby erfährt, wie man mit negativen Gefühlen umgehen kann. Auch kann es hierdurch zur weiteren Entwicklung angeregt werden: Wer sofort alles gereicht bekommt, wenn er etwas quengelt ist nicht darauf angewiesen, sich selbst zu bewegen. Ein gewisses Maß an Unzufriedenheit ist also durchaus als Motor der Entwicklung zu betrachten. Umgekehrt wird einem Baby, dem jeder Wunsch schon von vornherein “von den Augen abgelesen wird”, um die Fähigkeit gebracht, sich selbst zu verstehen. Es lernt keine Selbstwirksamkeit, weil es nicht erfahren kann, dass es sich auch selbst helfen kann und darf. Winnicott findet daher, dass die “good enough mother” der “too good mother” gegenüber vorzuziehen ist. Wir müssen also nicht Supereltern sein, sondern einfach nur hinreichend gut!
Kinder brauchen andere Kinder
Natürlich bedeutet all dies nicht, dass Eltern nur noch Onlineaustausch benötigen und es kein Problem ist, wenn sie ständig auf das Handy schielen. Selbstverständlich kommt es auf das richtige Maß an. Aber wir brauchen auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir unseren Alltag online teilen. Wir müssen uns nicht ständig nur und ausschließlich auf die Familie konzentrieren. Wir dürfen uns austauschen, Rat und Unterstützung holen. Es ist normal. Und es hilft in so vielen Momenten.
Was wir dennoch nicht vergessen dürfen: Auch Kinder brauchen Gemeinschaft und Austausch. Sie brauchen konkrete, wirklich anwesende Personen zum Spiel, zur Auseinandersetzung, zum Lernen. Sie brauchen einen real vorhandenen Clan und Erfahrungen außerhalb der eigenen vier Wände. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns nicht nur online austauschen und einigeln, auch wenn wir dort jederzeit Antworten und Gemeinschaft finden können. Was für uns vielleicht eine gute Alternative ist bei mangelnden realen Kontakten, ist es für die Kinder nicht. Für sie müssen wir auch außerhalb von Twitter und Facebook Gruppen finden und Gleichgesinnte. Für sie und mit ihnen besuchen wir Babykurse und Krabbelgruppen und suchen auf Spielplätzen und in Turngruppen Menschen, die zu uns passen und mit denen wir auch im realen Leben ein Netzwerk aufbauen können. Aber wenn wir das haben, wenn wir gut eingebunden sind, dann spricht nichts dagegen, dass wir auch mal das Handy zücken und dort Gemeinschaft suchen und haben.