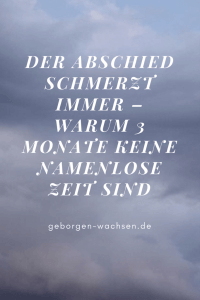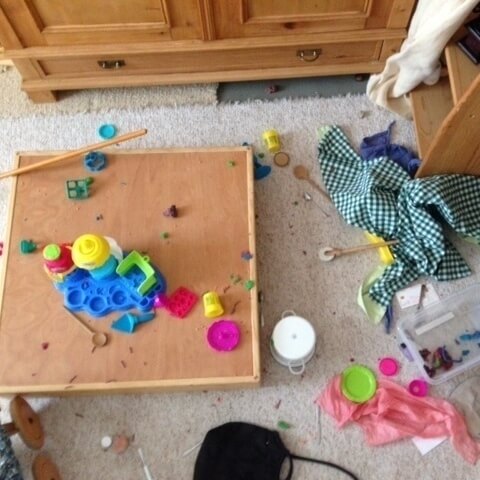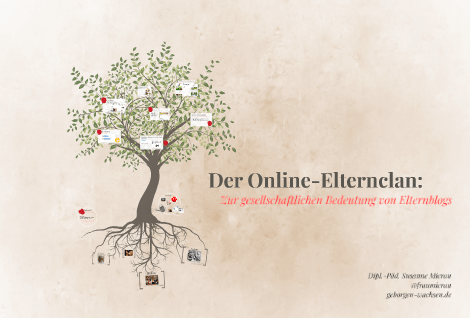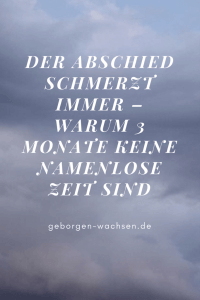Eine Freundin von mir hat ihr Kind in der 8. Schwangerschaftswoche verloren*. Sie war noch „ganz am Anfang“, wie es heißt. Kaum jemandem hatte sie davon berichtet aus der Angst, dass doch etwas „schief gehen“ könnte. Es ging schief. Sie verlor ihr Kind. Doch wie geht man damit um, wenn man niemandem etwas davon gesagt hat? Wie kann man seinen Schmerz in Worte fassen gegenüber Menschen, die vorher nichts wussten? Und warum überhaupt ist es so, dass wir drei Monate niemandem etwas sagen von dem neuen Leben, das in uns wächst?
Ich stellte mir bei jedem meiner Kinder die Frage, wann ich Freunden und Verwandten von der Schwangerschaft berichten sollte. Ich kenne diese „magische Dreimonatsgrenze“, wie alle Schwangeren sie kennen. Letztlich war es jedoch so, dass ich es erzählte, sobald ich es wusste. Einfach deswegen, weil ich es nicht für mich behalten konnte vor Glück und auch, weil ich wusste, dass es keinen Sinn macht, es zu verbergen. Wenn ich Glück haben würde und die Schwangerschaft über die drei Monate hinaus gehen würde, würde ich es sowieso erzählen. Wäre dies nicht der Fall, würde ich Trost und Zuwendung benötigen von den Menschen in meiner Nähe. Und in einigen Fällen, so war ich mir sicher, würden auch sie trauern wollen um das, was ich hätte verlieren können.
Die ersten drei Monate einer Schwangerschaft – Zeit, in der nichts passiert?
Die ersten drei Monate einer Schwangerschaft sind eine besondere Zeit. In ihnen passiert sowohl körperlich als auch psychisch viel bei den werdenden Eltern, besonders der Mutter. Der Hormonhaushalt verändert sich, die Periode bleibt aus. Das Hormon Progesteron bewirkt, dass man häufiger auf die Toilette gehen muss. Die Hormone bewirken auch – zusammen mit dem gesteigerten Stoffwechsel und niedrigem Blutdruck – Müdigkeit und Schwindel. Der Magen ist empfindlicher, die Nase ebenfalls. Progesteron und Östrogen wirken entspannend und machen den Darm träge. Das Schwangerschaftshormon hCG verursacht die in der Schwangerschaft bekannte Übelkeit. In den ersten Monaten findet meistens noch keine oder nur eine geringe Gewichtszunahme statt, obwohl zum Beispiel die Gebärmutter eine große Leistung in Hinblick auf das Wachstum erbringt. Sichtbar wird die Schwangerschaft zum Ende des 3. Monats dann oft eher am Busen, weil dieser wächst und sich bereits jetzt auf die Stillzeit vorbereitet.
Und auch psychisch tut sich in diesen Monaten sehr viel: Freude, Überraschung, Unentschlossenheit, Kummer, Sorgen, Glück,… Es gibt viele Gefühle, die in den ersten Monaten wahrgenommen werden. Schwangere stellen sich viele Fragen von der Notwendigkeit einer Feindiagnostik bis hin zum möglichen Geschlecht des Kindes. Mutter werden jetzt schon oder jetzt noch? Kann ich das, will ich das? Wie verkraftet unsere Beziehung das? Werde ich vielleicht Alleinerziehend sein?
Sowohl durch die körperliche als auch durch die psychische Umstellung sind Frauen in den ersten Monaten der Schwangerschaft in einem besonderen Zustand, in dem sie gerade besonders viel Zuwendung brauchen. Gerade jetzt brauchen sie Gesprächspartner, um Sorgen und Glücksmomente zu teilen. Sie brauchen konkrete Bezugspersonen, bei denen sie auch Rat einholen können: Was kann man gegen Übelkeit unternehmen? Ist es normal, so oft auf Toilette zu müssen? Gerade die ersten drei Monate sind also keine Zeit, in der eigentlich ein Geheimnis aus der Schwangerschaft gemacht werden sollte.
Guter Hoffnung sein ist heute nicht mehr einfach
„Guter Hoffnung“ sein – das gilt eigentlich auch schon für diese Zeit. Aber wer traut sich das heute noch, einfach so voll von guter Hoffnung zu sein? „Guter Hoffnung“ zu sein bedeutet nämlich auch, nicht vom Schlimmsten auszugehen, sondern davon, dass es gut und normal verläuft. Ja, es gibt Fehlgeburten. Und diese sind besonders in den ersten Monaten vertreten, wenn das „Alles-oder-nichts-Prinzip“ herrscht. Das Risiko für eine Fehlgeburt hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Doch auch gerade über diese Ängste muss man sich austauschen können. „Guter Hoffnung“ zu sein, bedeutet, sich anderen anzuvertrauen und über den neuen Umstand sprechen zu können.
Vom richtigen Umgang mit einem frühen Abschied
Und wenn es doch passiert, der Verlust? Man ist nicht von heute auf morgen nicht mehr schwanger. Oft lassen die Schwangerschaftsanzeichen erst langsam nach. Auch wenn das Kind sich schon verabschiedet hat, braucht der Körper noch eine Weile, um das zu verstehen – und die Seele oft mindestens genauso lang, wenn nicht länger.
Wenn ein Kind geht, müssen wir uns verabschieden von Wünschen, Vorstellungen, Erwartungen. Mit dem positiven Schwangerschaftstest in der Hand wird eine Flut von Gedanken ausgelöst: Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Wie wird das Kind wohl aussehen? Wird es so gern malen wie ich oder mathematisch begabt wie der Vater? Was wird mit meinem Job, wie lange werde ich aussteigen? Wir machen uns Gedanken und es bilden sich Vorstellungen über eine Zukunft mit dem Kind. Vielleicht war die Schwangerschaft lange heiß ersehnt. Oder es gab schon zuvor Verluste. Gerade auch dann ist der Sturz vom Glückstaumel in die Trauer sehr groß. Doch wie auch immer die Ausgangslage war: Es gibt kein „trauriger sein“ als jemand anderes, der einen Verlust erlitten hat. Jeder Abschied ist schmerzhaft, ob es eine überraschende oder eine ersehnte Schwangerschaft war.
Und genau deswegen ist auch jeder Abschied es wert, betrauert zu werden. Ich habe schon oft von Frauen, die einen frühen Verlust in den ersten drei Monaten hatten, gehört, dass man in ihrem Umfeld erklärte, dass das ja noch kein richtiger Mensch gewesen sei, dass sie nicht traurig sein sollten oder dass sie froh sein sollten, dass der Verlust nicht später eingetreten ist, wenn es schon ein „richtiges Baby“ gewesen sei. Doch das ist nicht richtig. Das Kind nimmt nicht mit seiner Größe Gestalt in unseren Vorstellungen an, sondern mit seiner bloßen Existenz. Es gibt keinen geringeren Schmerz, nur weil das Kind erst wenige Millimeter groß ist. Ein Schmerz ist ein Schmerz.
Wer einen Verlust in der Schwangerschaft erleidet, hat jedes Recht darauf, zu trauern. Es ist gut, eine Hebamme an der Seite zu haben, die die Trauer begleiten kann. Es ist sehr wichtig, mit anderen Menschen über die Gefühle zu sprechen, die Trauer zu teilen, aufgefangen zu werden. Der Verlust eines Kindes ist ein Trauma. Zur normalen Bewältigung eines Traumas gehört es, mit nahen Menschen über das Erlebte zu sprechen. Oft muss mit mehreren Menschen wieder und wieder die Geschichte geteilt werden bis das Erlebte bewältigt ist und man es verarbeitet hat. Zahlreiche Internetforen und Blogs sind Beispiele dafür, wie wichtig es ist, sich mitzuteilen. Doch sie sind auch oft Beispiele dafür, wie wenig es im realen Leben, im Alltag, die Möglichkeit gibt, mit den Menschen der Umgebung über die Situation zu sprechen. Teils aus Scham, aus dem Gefühl, andere nicht belästigen zu wollen oder Freundschaften nicht zu überstrapazieren, wird dem Gespräch unter vier Augen aus dem Weg gegangen. Und zu einem großen Teil auch deswegen, weil man eben nicht weiß, wie man anfangen soll, wenn man den anderen noch nichts von seiner Schwangerschaft erzählt hat. Der Satz „Ich war schwanger…“ kommt nicht leicht über die Lippen.
Rituale können dabei helfen, einen Abschied in Worte oder in eine Handlung zu fassen. Gerade am Anfang, wenn man noch keine Kindsbewegungen gespürt hat, ist es manchmal schwer zu begreifen, dass das Baby nicht mehr da ist – man hatte ja schon kaum glauben können, dass es da war. Abschiede können auf sehr unterschiedliche Weise gestaltet werden. Es werden kleine Boote mit einer Kerze auf dem Wasser fahren gelassen, eine Skylaterne in die Luft geschickt oder es kann symbolisch etwas begraben werden.
Einen guten Blogartikel über die Erfahrungen einer Frau mit einem frühen Verlust in der Schwangerschaft habe ich hier gefunden.
Auch ein geplanter Abschied kann betrauert werden
Vor Jahren habe ich einmal eine Frau begleitet, die sich gegen die Schwangerschaft entschieden hatte. Es war ihre ganz persönliche Entscheidung – wie es immer eine ganz persönliche Entscheidung ist. Ich bewerte diese Entscheidungen nicht, denn es gibt keine Gründe, die wichtiger wären oder welche, die weniger wichtig sind. Man kann nicht sagen: „Also das ist nun wirklich ein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch.“ Oder „Das ist kein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch“. Oft bleiben die wahren Gründe für alle Menschen außerhalb der eigentlich Person sowieso im Unklaren. Wer sich dafür entscheidet, hat seinen ganz persönlichen Grund. Wie ich es aus meiner Arbeit kenne, sind diese Entscheidungen meistens keine einfachen. Man entscheidet nicht nebenher und über Nacht, dass man eine Schwangerschaft abbrechen möchte. Die Frau, die ich begleitete, entschied sich in den ersten 10 Wochen dafür, das Kind nicht austragen zu wollen. Sie war traurig, bestürzt, auch wütend. Sie hatte Angst. Und sie trauerte. Sie trauerte noch während sie das Kind in sich trug, dass sie sich von ihm verabschieden müssen würde. Sie war verunsichert, wie sie sich verabschieden könnte, denn sie hatte kaum Menschen in ihren Umstand eingeweiht. Für sie war wichtig zu wissen: Hebammenhilfte steht einer Schwangeren auch im Falle eines medizinischen Schwangerschaftsabbruchs zu. So können mit der Hebamme alle Dinge besprochen werden und man hat einen vertrauten Partner an der Seite. Darüber hinaus brauchte sie jedoch auch ein Ritual, um Abschied zu nehmen von dem Kind, das sie in sich trug. Sie schrieb einen Brief an sich und das Kind, faltete ihn zu einem Boot und ließ ihn fahren. Doch sie hat damit nicht ihre Gedanken fort geschickt. Sie ließ sich eine Träne tätowieren auf die Brust über das Herz. Für dieses Kind, das sie nicht austragen wollte. Auch wenn es in den ersten drei Monaten war, hat sie es nie vergessen. Denn auch sie zählen, diese ersten drei Monate. Man ist nicht erst ab dem vierten Monat schwanger.
* Mit ihrer Genehmigung schreibe ich diesen Beitrag über ein Thema, das auch sie sehr beschäftigt hat.
Merke Dir diesen Artikel auf Pinterest