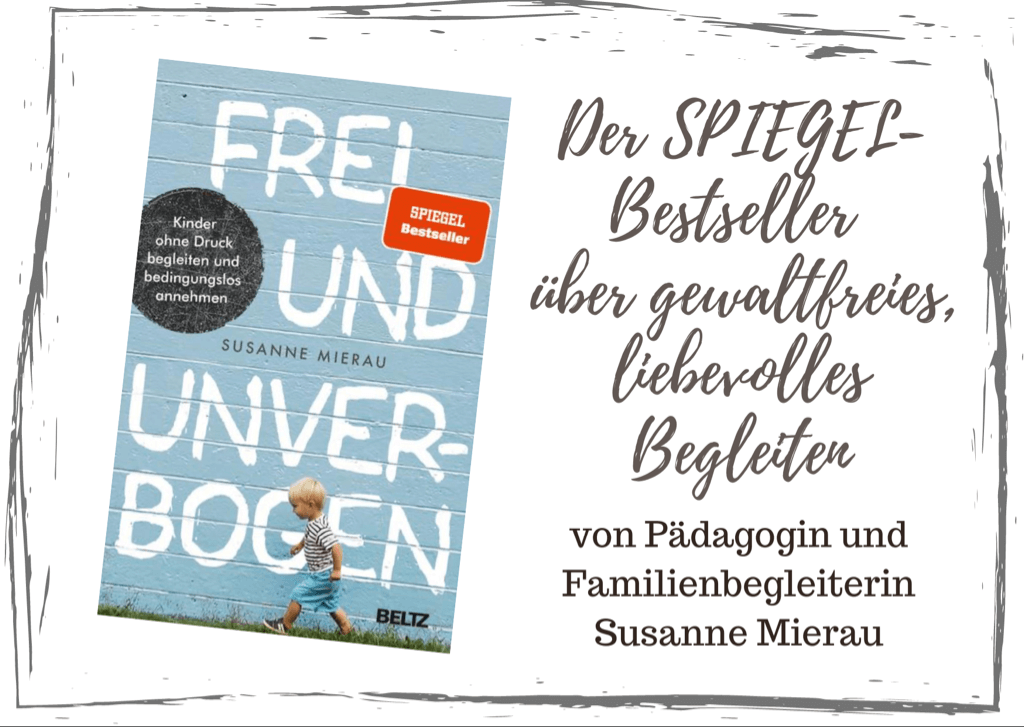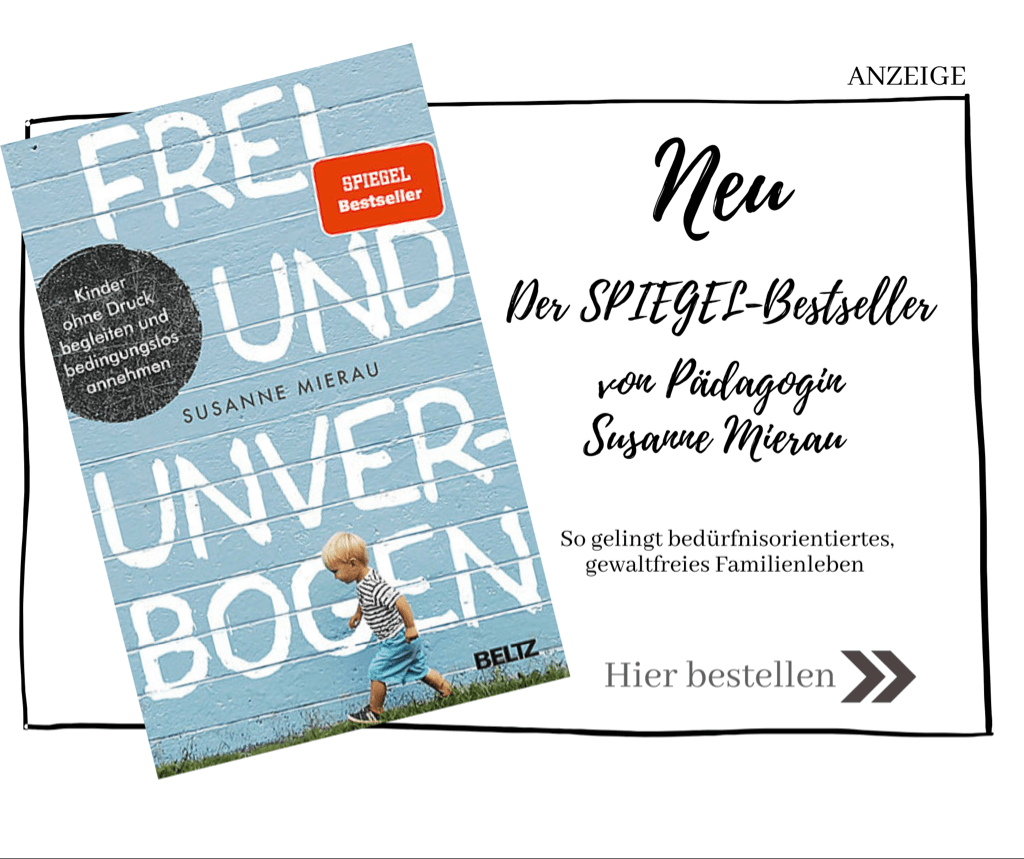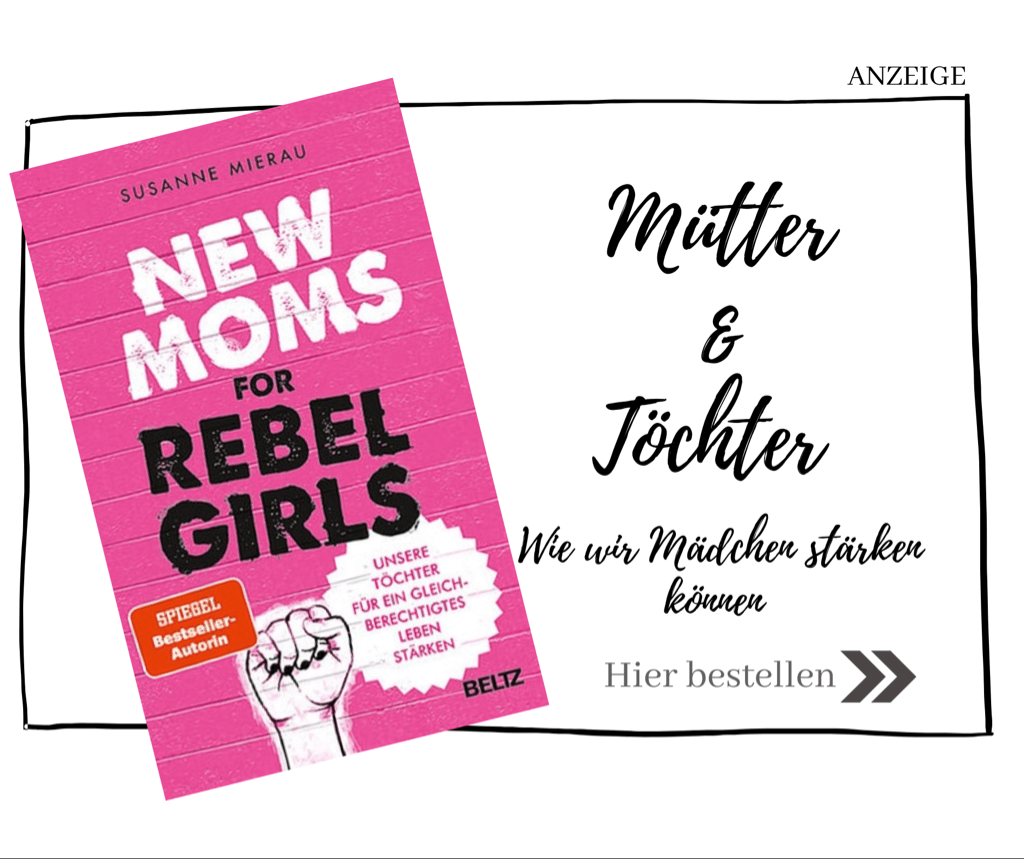Kommunikation ist ein wesentlicher Teil unseres Miteinanders und gleichzeitig fällt es uns manchmal so schwer, miteinander zu sprechen: unsere Wünsche und Erwartungen auszudrücken, uns durch Sprache abzugrenzen oder durch Sprache auf unsere Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Während viele Kinder recht klar in ihrem Ausdruck sind, haben wir Erwachsene oft viel größere Schwierigkeiten. Manchmal aus der Angst heraus, als Elternteil unfreundlich oder nicht ausreichend rücksichtsvoll zu sein oder auch aus dem Wunsch heraus, Probleme zu umschiffen. Für unsere Kinder aber ist es wichtig, dass wir klar ausdrücken, was wir uns für uns oder von ihnen wünschen.
Erwartungen und Wünsche klar formulieren
„Könntest du vielleicht bitte den Tisch abräumen?“, „Möchtest du jetzt die Socken wegräumen?“ – Was in unseren Erwachsenenohren freundlich und zugewandt klingt, ist für kleine Kinder manchmal nicht eindeutig genug. Sie können unsere Absicht nicht herausfiltern aus der Frage. Deswegen ist es wichtig, dass wir Aufforderungen und Wünsche klar formulieren. Das bedeutet nicht, dass wir deswegen unfreundlich sein müssen: Mit einer zugewandten Körperhaltung, einem netten Tonfall und freundlicher Mimik können wir klar formulieren: „Bitte räum jetzt den Tisch ab.“ oder „Bitte räum die Socken jetzt weg.“
Keine doppelten Botschaften, kein Sarkasmus
Doppelte Botschaften sind für Kinder (und oft Erwachsene) ein großes Kommunikationsproblem: Hier wird eine inhaltliche Aussage mit einer anderen, widersprechenden Botschaft kombiniert: „Ich helfe dir gerne, aber das machst du alleine!“, „Sag mir, was du gemacht hast, ich bin nicht böse!“ mit bösem Gesichtsausdruck und/oder drohender Körperhaltung sagen. Sarkasmus können Kinder in der Regel in der Kleinkind- und Vorschulzeit noch nicht gut verstehen und reagieren daher falsch (aber aus ihrer Perspektive richtig) auf sarkastische Äußerungen.
Keine Fragen, wenn es eigentlich keine Optionen gibt
„Was soll ich heute zum Abendessen machen?“ kann eine lieb gemeinte Frage sein. Wenn das Kind aber ehrlich mit „Pommes und Burger“ darauf antwortet und diese Wahl aber eigentlich keine Option ist, kann das zu Konflikten führen. Sinnvoller ist es deswegen, wenn nur dann eine offene Frage gestellt wird, wenn die Antwort des Kindes auch tatsächlich eine Option ist. Kleinkinder können zudem von offenen Fragen und zu viel Entscheidungsfreiheit überfordert sein. Hilfreicher ist dann eine Frage wie: „Möchtest du zum Abendessen Brot oder die Nudeln vom Mittagessen?“
Ein typisches anderes Feld, in dem oft Fragen gestellt werden, obwohl eigentlich eine Aufforderung gemeint ist, ist das Aufräumen: „Möchtest du jetzt dein Zimmer aufräumen?“, „Kannst du jetzt dein Zimmer aufräumen?“ Auch hier ist es hilfreich, eine klare Aussage zu treffen, anstatt eine Frage zu formulieren. Der Anspruch, dass ein Kleinkind allein selbständig aufräumen kann, ist oft zu hoch gegriffen. Sinnvoller ist eine klare Aussage wie „Wir räumen jetzt gemeinsam auf. Du sammelst alle Kuscheltiere ein und ich alle Bausteine.“
Uneindeutige Äußerungen führen zu Problemen
Wir wollen unsere Kinder liebevoll und respektvoll begleiten. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir nicht eindeutig mit ihnen sprechen können. Wir schaffen es auch nicht, durch liebevolle Ansprachen Konflikte zu umschiffen, die sich daraus ergeben, dass das Kind vielleicht von unserem Wunsch oder unserer Aussage nicht begeistert ist. Im Gegenteil: Uneindeutige Äußerungen von Erwachsenen können zu größeren Konflikten führen, weil das Kind sie nicht richtig versteht, die erwachsene Person deswegen verärgert ist und es dann zum Streit kommt, weil das Verhalten des Kindes als Angriff auf der Beziehungsebene verstanden wird („Das ist ein Machtspiel!“, „Du willst mich nicht verstehen!“) anstatt auf der Inhaltsebene (Das Kind will gerade nicht aufräumen).
Deswegen: Bedürfnisorientiertes und respektvolles Begleiten von Kindern und eine klare, eindeutige Ansprache schließen sich nicht aus. Im Gegenteil: Sie kann dazu beitragen, offen und lösungsorientiert über Probleme und Bedürfnisse zu sprechen.
Eure
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und kindliche Entwicklung. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und kindliche Entwicklung. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de