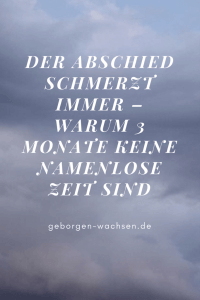Darüber, wie wir unseren Weg zur Elimination Communication (EC) gefunden haben, habe ich ja bereits ausführlich berichtet. Es war der Sohn, der mit Vehemenz immer wieder zum Ausdruck brachte, dass er das mit den Windeln bzw. mit den vollen Windeln wirklich nicht so toll findet. Nun, mit 15 Monaten, sagt er jedes mal „Kacka“, wenn er dieses Bedürfnis verspürt. Seit ca. 2 Monaten hatten wir nun keine Windel mehr, die ein großes Geschäft beinhaltete und auch davor nur selten Situationen, in denen wir zu langsam waren, ihn zur Toilette zu bringen und rechtzeitig von den Windeln zu befreien. Denn wenn man EC mit dem Kind macht, ist eines besonders wichtig: Die Wahl der Windel, wenn das Kind denn welche trägt.
Im Sommer ist Elimination Communiaction besonders einfach. Es ist warm, das Baby oder Kleinkind kann wunderbar in einem langen Hemd oder einer lockeren Splitpants durch die Gegend laufen und man hält es ab, wenn es dies signalisiert. Natürlich können auch Windeln genutzt werden, besonders für unterwegs, aber es muss tatsächlich nicht sein. Wer aber Windeln im Sommer auch unterwegs nutzt und wer besonders im Winter das Problem des Zwiebellooks kennt, der weiß: Wenn das Kind sein Bedürfnis anmeldet, sollte man es schnell ausziehen können. Langes Ausziehen ist also eher ungünstig. Aber wie passt das mit Stoffwindeln zusammen?
Als ich zum ersten Mal mit meinem Mann über Stoffwindeln sprach, war er völlig abgeneigt. Bei Stoffwindeln dachte er nämlich an Mullwindeln und Bindewindeln. Diese kannte er noch aus der Kindheit und war gar nicht davon überzeugt, sie bei uns zu nutzen. Als ich ihm dann aber erklärte, dass sich seither auf dem Stoffwindelmarkt viel getan hat und es Stoffwindeln gibt, die wie Wegwerfwindeln angelegt werden, kamen wir doch ins Gespräch.
Nachdem wir uns im Hug & Grow etwas in die riesige Auswahl an Stoffwindeln eingearbeitet hatten, haben wir uns zunächst für ein Startpaket mit TotsBots Bamboozles entschieden. 20 dieser Höschenwindeln aus Bambusrayon und Polyester wurden vor dem Tragen einige male gründlich gewaschen und getrocknet, damit sie wirklich saugfähig sind. Es gibt sie in 2 Größen. Wir hatten zunächst von jeder Größe 10, hätten aber auch von Anfang an Größe 2 benutzen können und haben dann die 1er Windeln schnell wieder verkauft (übrigens annähernd zum Einkaufspreis) und 2er nachgekauft. Der Unterschied zwischen Größe 1 und 2 war nicht besonders groß und im Steg sind die sowieso beide identisch. Mittels Druckknöpfen kann die Windel noch verkleinert werden. Im Innenteil der Windel wird eine separate Einlage mit Druckknöpfen befestigt, wodurch die Windel wirklich sehr saugfähig ist. Auch nach einem Jahr Nutzung ist sie noch immer in einem guten Zustand: Das Material ist weich und saugstark, die Klettverschlüsse schließen sehr gut. Sie sitzt toll und verrutscht auch bei viel Bewegung nicht. Für die Nacht ist sie ein sehr guter Begleiter, denn sie nimmt wirklich viel Feuchtigkeit auf ohne für das Kind unangenehm zu werden. In Hinblick auf Elimination Communication kommt nun aber der Haken: Es ist eben nur eine Höschenwindel. Zum Nässeschutz benötigt man eine Überhose wie beispielsweise eine Wollhose. Und damit hat man schon etwas mehr Aufwand, wenn es mal schnell gehen soll. Und: Ab und zu geht schon ein bisschen was in die Windel. Wenn der Sohn dann aber aufs Töpfchen geht, möchte ich ihm danach nicht die etwas nasse Windel wieder anziehen, sondern eine trockene. So ist der Waschaufwand recht hoch, obwohl jede Windel nur wenig nass wird.

Also machte ich mich auf die Suche nach einer Alternative zur klassischen Höschenwindel, zumindest für den Tag. Dabei stieß ich auf verschiedene Systeme: All-in-one-Windeln, Pocketwindeln, Snap-in-one-Windeln (beide All-in-Two, wie übrigens auch die Höschenwindeln in diese Kategorie fallen) und All-in-Three. Zunächst probierte ich eine All-in-one-Windel aus: Hier ist tatsächlich alles in einer Windel zusammen. Die Einlage ist direkt an der Windel befestigt und um die Windel herum befindet sich eine Nässeschutzschicht. Die Windel ist deswegen ganz schnell einsatzbereit, man muss absolut nicht vorher zusammenklicken oder einlegen und man kann sie dementsprechend schnell ausziehen. Gute Idee also für EC. Ich habe eine Swaddlebee Simplex aus dem Hause Blueberry probiert. Die Einlage ist an der Windel befestigt. Da es jedoch auch eine Innentasche gibt, können zusätzlich zu dieser Einlage noch weitere Einlagen hinzugefügt werden (wie bei einer Pocket-Windel, siehe unten). Auch hier gibt es Druckknöpfe, um die Windel zu verkleinern und sie wird auch über Druckknöpfe geschlossen, wodurch sie wirklich sehr fest hält. Auch der Sitz ist gut. Verwendet man nur die festgenähte Einlage, ist die Saugkraft nicht so stark wie bei der TotsBots Bamboozle, aber in Kombination mit EC passt das gut, da ja auch weniger in die Windel geht und im Idealfall dafür mehr in die Toilette. Nachteil gegenüber den weiter unten aufgeführten Windeln ist natürlich, dass sie komplett in die Wäsche muss. Und wie bei der Höschenwindel: Eine nasse Windel wird nicht noch einmal angezogen.

Auf den Geschmack gekommen, wollte ich nun auch eine Pocketwindel ausprobieren, Prinzip All-in-two. Auch hier gilt wieder: Überhose ist mit dran. Sie hat allerdings eine Tasche, in die die Einlage geschoben wird. Man kann also auch verschiedene Einlagen oder mehrere Schichten einlegen. Ausprobiert habe ich eine Bumgenius aus dem Hause Cotton Babies. Zur Windel gehören zwei Microfasereinlagen, die in die Tasche geschoben werden können (wie gesagt können aber auch andere Einlagen genutzt werden). Die mitgelieferten Einlagen sind aber gut in ihrer Saugkraft, sitzt gut und hat für EC einen tollen Vorteil, denn sie lässt sich sehr gut und schnell dank der Klettverschlüsse ausziehen und es fällt rutscht die Einlage nicht zur Seite oder fällt nach hinten während des Abhaltens wie es bei einer All-in-one passieren kann. Nach dem Waschen trocknet sie sehr schnell, schneller als die TotsBots Bamboozles. Nachteil: Entweder muss die gesamte Windel gewaschen werden oder die nassen Einlagen müssen aus der Tasche heraus gezogen werden, was für manche vielleicht unangenehm ist. Aber es ist möglich, die Windel mehrmals zu benutzen und nur die Einlage zu wechseln, was dann zu weniger Waschaufwand führt.

Natürlich musste es dann zum Vergleich auch noch eine Snap-in-one-Windel sein, die ja auch nach dem All-in-two-Prinzip funktioniert. Hier gibt es eine wasserundurchlässige Außenschicht und die Einlagen, die eingeklickt oder gelegt werden. Dabei kam ich auf die GroVia Hybrid. Auch sie ist mit Druckknöpfen in der Größe verstellbar, verfügt aber über Klett zum Schließen. Die Außenschicht ist recht dünn und wird auch recht schnell etwas feucht, wodurch das System des mehrfachen Auswechselns der Einlagen nicht ganz so gut aufgeht. Je nachdem welche Einlagen verwendet werden, können sie beim Ausziehen auch runter fallen oder verrutschen, sind also nur bedingt EC geeignet. Sie lässt sich aber auch sehr gut und leicht öffnen.

Und schließlich bin ich dann noch bei einer All-in-Three-Windel angelangt. Hier gibt es eine Außenwindel, eine Innenwindel zum Einklicken und die Einlage. Stephanie Oppitz und die Windelmanufakturwindeln lernte ich über meine Kollegin Anne Weidlich kennen. Und was Anne mir vorschwärmte, hielt dem Test stand: Eine Windel mit tollen Stoffen für die Außenwindel und sogar der Möglichkeit, sich selbst den Stoff für die Außenwindel auszusuchen oder einen Wunschstoff für die Windel zuzuschicken. Unter den Stoffwindeln also die Königin der Designmöglichkeiten! Darin befindet sich eine wasserfeste Innenwindel aus PUL, die sich gut anschmiegt und nicht ausläuft und in die verschiedene Einlagen gelegt werden können. Obwohl die Einlagen nicht an der Innenwindel befestigt werden, werden sie so eingelegt, dass sie beim Öffnen im Stehen nicht heraus fallen. Die Einlagen können mehrfach ausgewechselt werden, bevor die gesamte Windel gewaschen werden muss, wodurch sich die Wäschemenge wirklich reduziert. Somit ist auch diese Windel eine tolle Kombination für EC.

Mein Fazit also lautet: Für EC ist die Kombination mit All-in-Three wie bei der Windelmanufaktur oder einer Pocketwindel sehr praktisch. Sie können schnell an- und ausgezogen werden, das auch gut im Stehen, ohne dass Teile der Windel verloren gehen oder beschmutzt werden beim Abhalten. Für nachts, wo der Sohn nicht abgehalten wird, ist auch weiterhin die Höschenwindel der Favorit. Wer noch einen besseren Überblick über die verschiedenen Windelsysteme benötigt, die ich hier vorgestellt habe, findet ihn hier oder auch detaillierte Informationen zu einzelnen Produkten im kostenlosen Windel-Ebook vom Hug & Grow.
Stoffwindeln und EC findest Du interessant und möchtest gerne auch andere Familien hierzu beraten? Dann ist vielleicht unser Workshop „GfG-Babypflege“ das Richtige für Dich. Hier lernst Du alles Wissenswerte zu Stoffwindeln, EC und Babypflege.