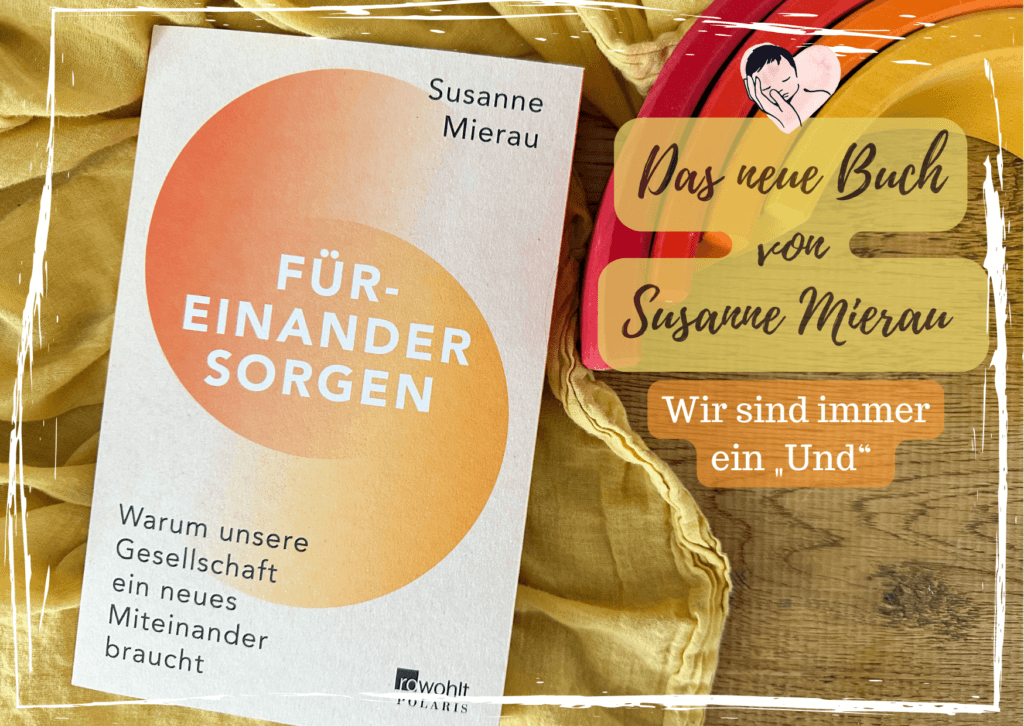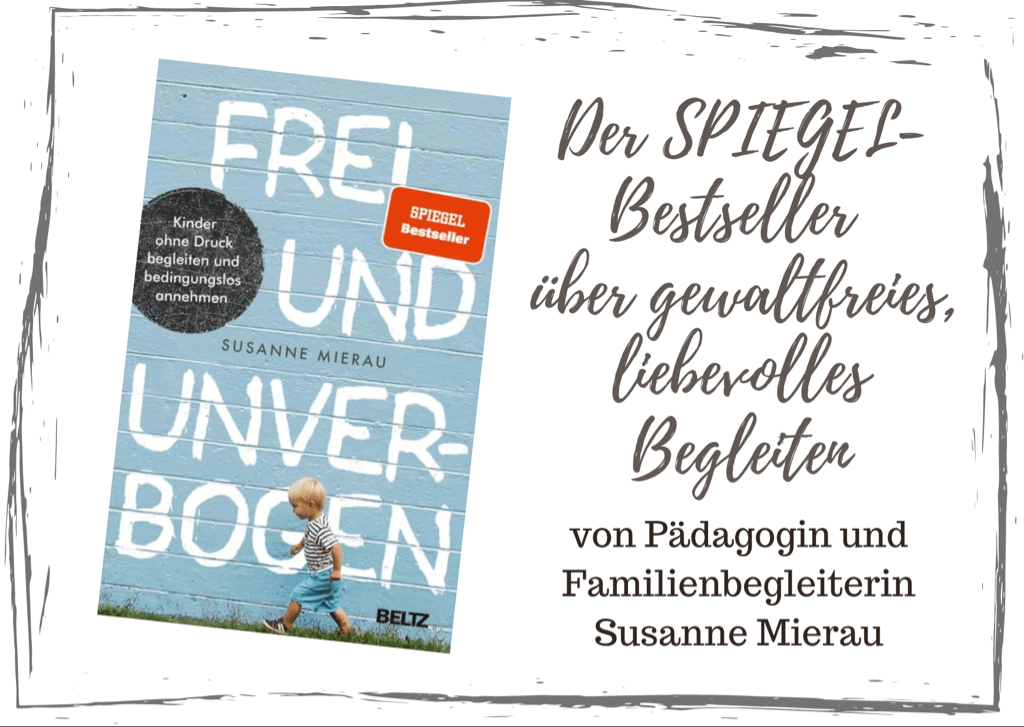„Mütter können das eben besser!“, „Mütter haben das im Gefühl!“ Diese und ähnliche Sätze kennen viele Eltern. Sie zementieren den Glauben daran, dass Mütter ihre Kinder besser versorgen könnten, weil sie eben Mütter sind. Tatsächlich aber ist das Umsorgen etwas, das wir zu großen Teilen erlernen. Durchaus gibt es einige in uns angelegte Verhaltensweisen, die quasi instinktiv erfolgen: Dass wir in der Regel auf das Weinen eines Babys mit Zuwendung reagieren etwa oder dass wir Babys mit einer höheren Stimmlage mit längeren Pausen ansprechen, der Augenbrauengruß. – Aber selbst dies sind keine Verhaltensweisen, die insbesondere Mütter zeigen, sondern Verhaltensweisen von Menschen. Selbst Kinder reagieren auf weinende Babys und zeigen eine Veränderung ihrer Sprache, wenn sie sich ihnen zuwenden.
Jedes Kind ist anderes
Dass wir erst lernen müssen, wie wir Kinder versorgen, ist durchaus sinnvoll: Schließlich kommen Kinder schon mit unterschiedlichen Ausdrucksarten und Bedürfnissen zu uns. Sie unterscheiden sich in Merkmalen wie der Erregbarkeit, der Tröstbarkeit und ihrem Ausdruck – bei jedem einzelnen Kind müssen wir erst lernen, wie genau es sich ausdrückt und wie wir es begleiten und co-regulieren können, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Hätten wir eine Standardeinstellung des Umsorgens, könnten wir den unterschiedlichen Bedarfen nicht gerecht werden. Da wir das Umsorgen des Kindes aber lernen, ist es möglich, sich nach und nach auf das Kind einzustellen. Hilfreich ist es natürlich, wenn wir schon einige praktische Handgriffe und Vorgehensweisen bei anderen abschauen konnten. Das Leben in Gemeinschaft hilft uns normalerweise, damit wir nicht ganz unvorbereitet in die Elternschaft gehen: Wir können etwas über den Umgang mit Babys und Kindern lernen, indem wir dies direkt in der Umgebung erleben, beispielsweise durch Geschwisterkinder, aber auch durch andere Familien mit Babys und Kindern im nahen Umfeld. Gerade das Stillen von Babys und Kleinkindern ist ein gutes Beispiel für erlerntes Verhalten von Eltern: Bestenfalls können wir bei anderen schon erfahren, wie ein Baby (auf vielfältige Weise) angelegt werden kann und wie das Stillen aussieht. Zumindest dann, wenn ein Elternteil selbst stillen möchte, braucht es oft Unterstützung durch eine andere erfahrene Person, Hebamme oder Stillbegleiterin.
Wir lernen es durch das Tun – geschlechtsunabhängig
Aber sind nun Mütter lernfähiger und stimmen die Mythen rund um den Mutterinstinkt vielleicht doch? Untersuchungen aus der Neurowissenschaft zeigen uns das Gegenteil: Wichtig für das Erlernen des Umsorgens ist, dass wir es tun, die Möglichkeit dazu haben und passende Rahmenbedingungen für das Umsorgen geschaffen werden. Je nachdem wie stark schon in der Schwangerschaft die Veränderungen des Gehirns sind, gelingt das Umsorgen später leichter oder schwerer, erklären Annika Rösler und Evelyn Höllrigl Tschaikner in ihrem Buch „Mythos Mutterinstinkt“. Einige Mütter brauchen mehr Unterstützung und Hilfe als andere. Sie schreiben (2023, S.73f.): „Die Sensibilisierung [für das Umsorgen durch Schwangerschaft und Geburt] bedeutet aber nicht, eine besondere Kompetenz qua Geburt (der eigenen oder des Kindes) erlangt zu haben oder instinktiv zu wissen, was zu tun ist. Und schon gar nicht auf Knopfdruck zu lieben. Aber in der Tat erhalten gebärende Frauen eine Art garantierte Eintrittskarte für das Abenteuer Elternschaft. Während sich nicht biologische Mütter, Väter, Adoptiveltern etc. diese Eintrittskarte erst einmal aktiv besorgen müssen. Also auch gewillt sein müssen, sich in dieses Abenteuer zu stürzen.“
Das Geschlecht spielt für den Lernprozess des Umsorgens keine erhebliche Rolle, auch wenn es einige Vorteile durch die bereits in der Schwangerschaft entstehenden Prozesse gibt. Während der Schwangerschaft, aber ganz besonders danach, verändert sich unser Gehirn – auch bei nicht-gebärenden Personen kommt es zu Veränderungen. Die tiefgreifenden neurologischen Veränderungen entstehen unter Einsatz von Zeit und Energie, wie die Wissenschaftsjournalistin Chelsea Conaboy in ihrem Buch „Mutterhirn“ beschreibt. Auch auf der hormonellen Ebene finden Veränderungen durch das Umsorgen statt: Auch Väter schütten mehr Oxytocin und Prolaktin aus, ihr Testosteronspiegel sinkt. Einige werdende Väter erleben sogar das Couvade-Syndrom, bei dem es zu Symptomen kommt, die denen der Schwangerschaft sehr ähneln (Gewichtszunahme, Schlaflosigkeit,…).
Muttertät
Schon in den 70er Jahren wurde von der Anthropologin und Doula Dana Raphael die Bezeichnung Matrescence für die Phase der Veränderung geprägt, der erst in den 2000er Jahren wieder aufgegriffen wurde im Bereich der Psychologie. Die Doulas Natalia Lamotte und Sarah Galan aus München haben für den Umwandlungsprozess des Mutterwerdens, der ein Lern- und Veränderungsprozeß in unserem Gehirn ist, den Begriff Muttertät erfunden: Er bezieht sich darauf, dass mit Beginn der Schwangerschaft ein teilweise mehrjähriger Prozess stattfindet, ähnlich der Pubertät, in dem Veränderungen auf körperlicher, psychischer und emotionaler Ebene stattfinden, die sich auf Beziehungen, Beruf und Weltsicht auswirken. Keineswegs ist das Muttersein also ein Prozess, der innerhalb der Schwangerschaft stattfindet und mit der Geburt abgeschlossen wird.
Eltern brauchen Zeit
Elternschaft ist ein Veränderungs- und Lernprozess. Leider herrscht noch immer der Gedanke vor, dass Eltern und insbesondere Mütter durch die Geburt sofort perfekte Eltern sein könnten. Das ist nicht nur unrealistisch, sondern lässt einen Druck entstehen, der sogar noch nachteilig wirken kann und zu Verunsicherung und Schuldgefühlen führt. Was Eltern brauchen, sind Verständnis, Unterstützung und vor allem Zeit. Gerade letzteres ist aber in unserer schnelllebigen Gesellschaft Mangelware, in der erwartet wird, dass Eltern sofort alles können sollten und ihnen gleichzeitig wenig Zeit gegeben wird, um sich wirklich dem Kümmern widmen und sich mit den eigenen Veränderungsprozessen auseinandersetzen zu können. Mütter wie Väter brauchen Zeit, um das Umsorgen des Kindes zu erlernen und sich selbst umsorgen und in der Veränderung annehmen und sich mit ihr auseinandersetzen zu können.
Eure
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und kindliche Entwicklung. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de