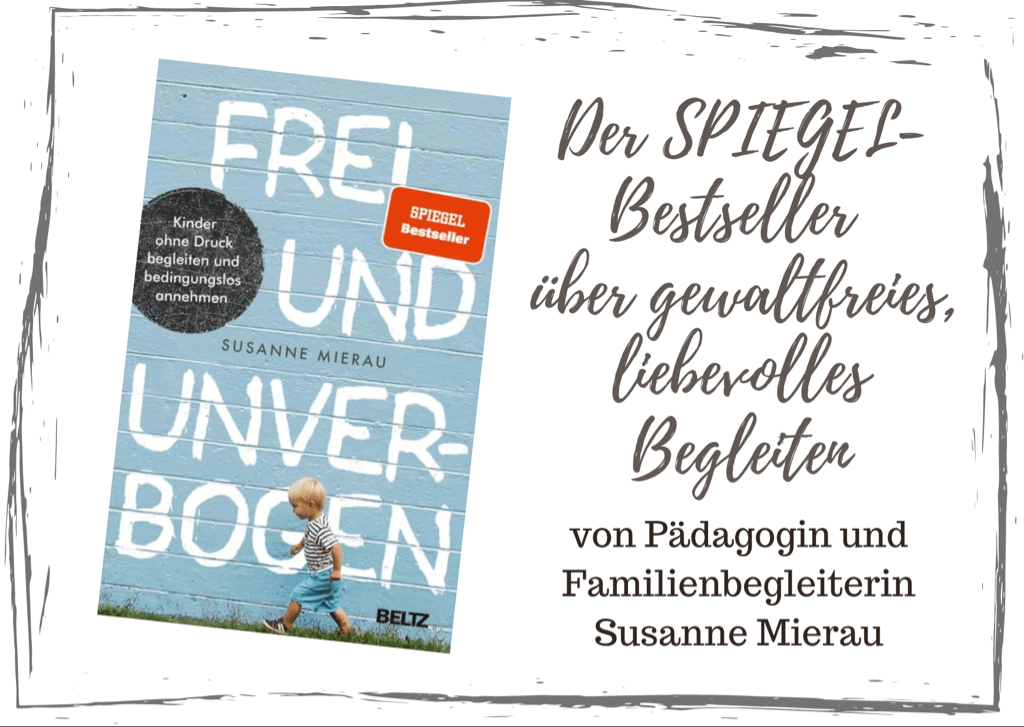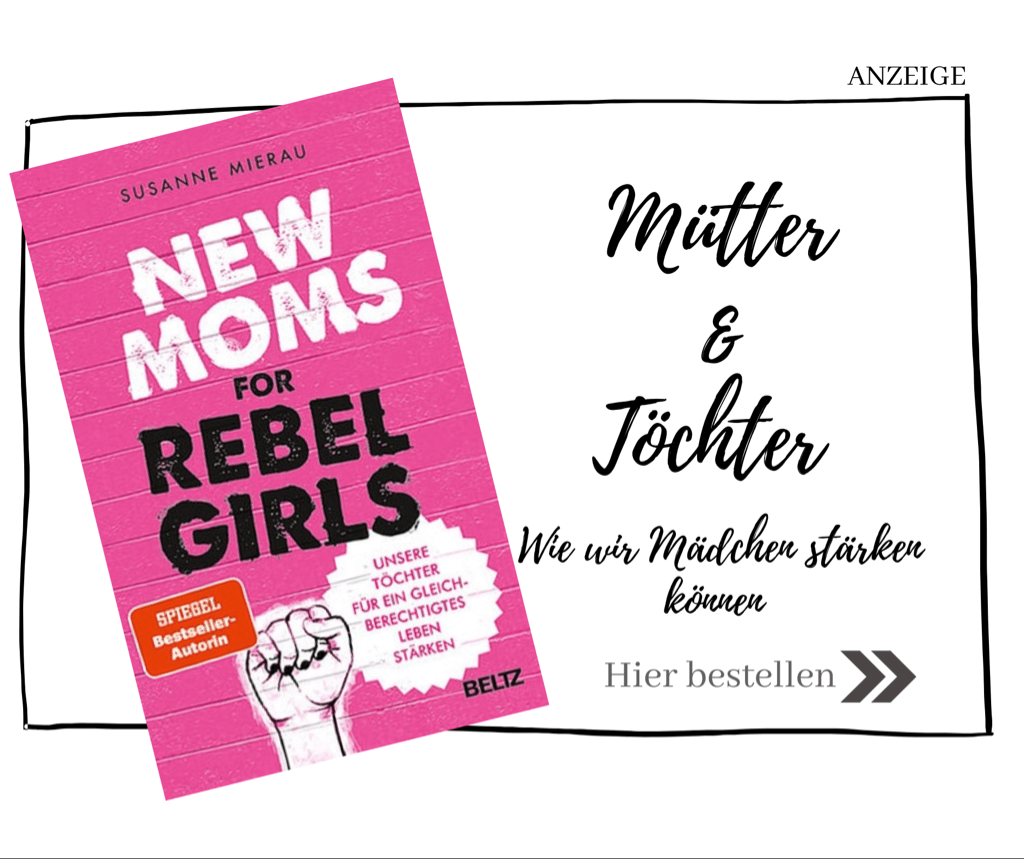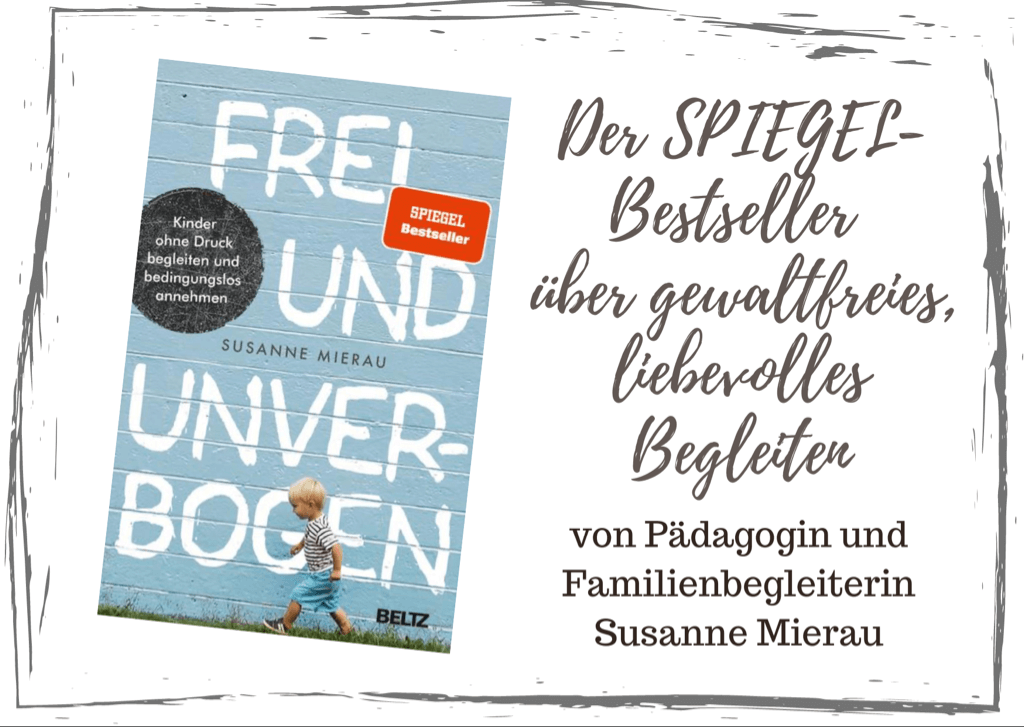Keine Frage: Kinder lernen die Welt erst kennen und können viele Situationen noch nicht so einschätzen, wie wir Erwachsene es tun würden. Ihnen fehlt Erfahrungswissen und ihre kognitive Entwicklung ermöglicht beispielsweise erst im fortgeschrittenen Schulalter, dass Distanzen und Geschwindigkeiten richtig eingeschätzt werden, was beispielsweise in Hinblick auf die Sicherheit im Straßenverkehr wichtig ist. Jenseits von diesen Umständen, in denen Eltern Entscheidungen für das Wohlergehen ihrer Kinder treffen müssen, gibt es aber einen breiten Raum für selbständiges Handeln, das die Kinder nicht nur einfordern, sondern das wir ihnen auch gewähren sollten.
Erkundungswunsch und Vertrauen sollten Hand in Hand gehen
Kinder brauchen das Gefühl, ihre Umwelt erkunden zu können, darin Erfahrungen zu machen und von den Eltern das dafür notwendige Vertrauen entgegengebracht zu bekommen. Die Haltung der Bezugsperson „Ich trau‘ dir das zu!“ motiviert gleichsam zum Ausprobieren, wie es auch die Beziehung stärkt, weil es dem Kind vermittelt, dass die Bezugsperson positiv und ressourcenorientiert auf das Kind blickt. Es tut gut, zu wissen, dass ein anderer Mensch uns etwas zutraut und uns als kompetent erachtet.
Natürlich kann es vorkommen, dass das Kind an Herausforderungen scheitert. Deswegen ist es wichtig, als Bezugsperson die Herausforderungen im Blick zu haben und nicht zu hoch anzusetzen, so dass das Kind wirklich dazu ermuntert wird, was im Rahmen der eigenen Möglichkeiten liegt. Scheitert es dennoch, kann es durch die liebevolle Verbindung aufgefangen werden: Es hat diesmal nicht geklappt, aber ich bin mir sicher, ein anderes Mal funktioniert es. Vielleicht hilft auch (bei größeren Kindern) die Frage: Wie kann ich dich unterstützen, damit du es beim nächsten Mal schaffst?
Wenn das Vertrauen schwerfällt
Manchmal fällt es Eltern auch schwer, dem Erkundungsdrang des Kindes zu vertrauen: Was, wenn es sich verletzt? Ist das nicht zu gefährlich? Das Abwägen von Gefahren ist wichtig, aber es sollte Eltern nicht davon abhalten, ein gutes Maß an Freiheit und Erkundung zuzulassen. Ohne das selbständige Erkunden kann das Kind nämlich nicht nur die eigenen Fertigkeiten nicht ausbauen und dem Entwicklungsbedürfnis nicht folgen, es verinnerlicht auch nach und nach, dass die Welt besonders gefährlich sei und es selbst darin nicht handlungsfähig ist. Langfristig kann sich besondere Ängstlichkeit der Bezugspersonen auf das Selbst- und Weltbild des Kindes negativ auswirken.
Wenn es Eltern immer wieder schwerfällt, dem Kind Freiraum zu geben, lohnt sich daher ein Blick auf die eigenen Gründe dafür: Warum fällt es mir so schwer, das Kind die Welt erkunden zu lassen? Was sind meine Ängste, woraus speisen sie sich? Habe ich selbst negative Erfahrungen gemacht, die mich heute so besonders vorsichtig sein lassen? Nicht immer liegt die Antwort für starke Vorsicht auf der Hand, manchmal benötigen Eltern auch Unterstützung, um sich der eigenen Ursachen bewusst zu werden und dann zu lernen, vertrauensvolle neue Wege zu gehen.
Die meisten Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder selbständig werden und irgendwann selbstbestimmt durch das Leben gehen können. Dafür ist es wichtig, dass wir ihnen aus einer sicheren Beziehung heraus mit Vertrauen die Freiheit geben, die Welt nach und nach kennenzulernen und sich in ihr zu bewegen. Gesunde Selbständigkeit wird gewonnen aus Sicherheit, Vertrauen und dem Wissen, dass bei Bedarf ein Mensch da ist, der einen wieder auffängt.
Eure
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und kindliche Entwicklung. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und kindliche Entwicklung. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de