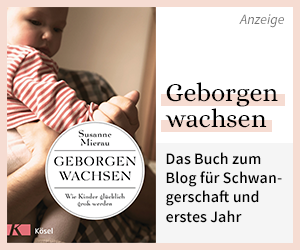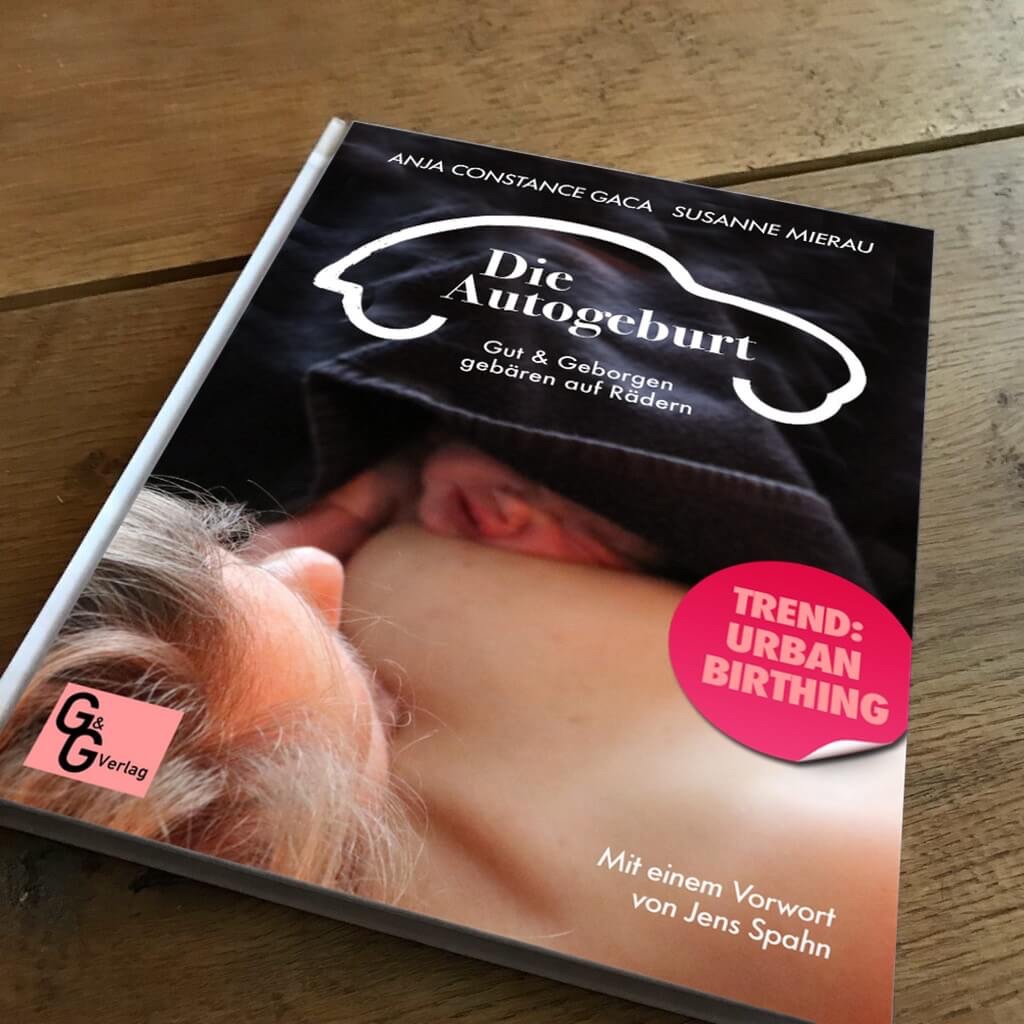Über beißende Kinder in der „Trotz“/Autonomiephase habe bereits hier schon einmal geschrieben. Anja von Von guten Eltern schreibt hier über beißende Stillkinder: wie es dazu kommt, wie das Beißen verhindert und wie die Brust bei einem Biss gepflegt werden kann.
Alle Artikel von Susanne Mierau
Einmal alles – Wie Kinder die bunte Palette der Gefühle erproben
Drei Kinder in drei unterschiedlichen Altersgruppen, das bringt viele Erfahrungen mit sich, viele Abenteuer, sehr viele Gefühle – und immer wieder auch unterschiedliche Emotionen. Drei Kinder im Alter von 9 Jahren, 5 Jahren, 2 Jahren: Es ist alles dabei von der „Trotz“phase über die Vorschulzeit-Wackelzahnpubertät bis zur „Vorpubertät“. Es gibt Lachen und unglaubliche Freude und es gibt zutiefst verwurzelten Ärger und es gibt laute, unbändige Wut. In unserem Haus gibt es alles, jedes Gefühl, weil sie jedes hier kennen lernen und ausprobieren im Schonraum der Familie bevor es hinaus geht in die Welt.
Diese unglaubliche Freude, die nur Kinder haben können: Eine Freude, die den ganzen Körper ergreift und sie wie einen Flummi durchs Zimmer hüpfen lässt. Eine Freude, die manchmal zu groß zu sein scheint für den kleinen Körper, die in Funken zu explodieren scheint und ansteckt in ihrem wilden Gekicher. Und ebenso wie es diese Freude gibt, gibt es auch die unglaubliche Wut, die wie dicker roter Nebel auf einmal im Raum steht. Eine Wut, die sich in einen Tornado verwandelt, der um das Kind kreist: Komm nicht näher, denn sonst wirst Du eingesaugt. Geh nicht weg, denn Du musst dennoch für Sicherheit sorgen. Und es gibt die schwere Decke der Trauer, die sich über ein Kind legen kann und die Tränen fließen lässt. Die manchmal fast zu schwer erscheint, um sie wegzuziehen, und es nur hilft, sich daneben zu legen und mitzutrauern, bis die Schwere durch die vielen geflossenen Tränen nachgelassen hat.
All diese Gefühle und ihre tausend kleinen Facetten erwarten uns im Leben mit Kindern. Naiv habe ich schon manches Mal gedacht: Nun habe ich aber wirklich alles erlebt und werde dann von meinem größten Kind eines besseren belehrt: Es gibt so viele Farben und Formen von Gefühlen. Und das, was wir mit ihnen erleben, verändert sich – und ist bei jedem Kind ein wenig anders. Die Verarbeitung von Gefühlen verändert sich und auch das, was sie erleben können und wollen. Denn sie setzen sich zuerst mit sich und ihren Gefühlen auseinander und dann mit denen der Umwelt.
https://twitter.com/fraumierau/status/1039244884438405121
Am Anfang des Lebens ist alles noch verwoben und unklar: Ein Bauchschmerz ist kein Bauchschmerz, sondern ein starker, stechender Schmerz im Körper, von dem nicht gewusst wird woher und wohin. Im Laufe der Zeit wird verstanden, was genau passiert, was empfunden wird. Und irgendwann kommt das Bewusstsein dazu, dass auch andere Menschen ganz anders fühlen. Es wird probiert, wie Empfindungen entstehen und wie sich der Mensch gegenüber verhält. Was ist hier und heute wie und wie ist es morgen? Nach und nach wird die Welt in Frage gestellt und damit einher entsteht Freude, aber auch Enttäuschung, Wut, Liebe. Nicht nur da draußen, sondern gerade auch hier drinnen in der Familie. Am ersten Ort, an dem all das ausprobiert wird.
Mein „Trotz“kind weiß manchmal nicht so recht, wogegen oder wofür es gerade ist. Es IST einfach nur und gibt sich dem Gefühl hin. Mein großes Schulkind hingegen ist oft schon ganz bestimmt gegen oder für etwas und erklärt das laut und stark. Manchmal bin ich verletzt von dem: vom kleinsten Kind, vom mittelsten oder auch vom großen. Auch hier wieder ganz unterschiedlich: von einem empörten Biss in den Arm, einem „Kackmama“ oder einem „Du liebst mich gar nicht!“. Aber ich weiß: Da müssen wir jetzt durch. All die Gefühle wollen hier ausprobiert werden und alle Antworten wollen hier zum ersten Mal durchgegangen werden, bevor sie woanders ausprobiert werden. Das hier ist der Schonraum, der Ort, an dem nicht nur das Laufen, sondern auch das Fühlen gelernt wird und die Antworten, die es darauf gibt. Und mit diesem Wissen ist es dann manchmal etwas einfacher, auch wenn es manchmal weh tut.
Eure

familieberlin: respektvoll zuhören auch bei kleinen Kindern
Nahezu alle Eltern kennen wahrscheinlich den Impuls, Sätze von Kindern zu ergänzen, wenn es mal schnell gehen soll oder den noch nicht vollständigen Sätzen nicht richtig zuzuhören. Bella hat hier darüber geschrieben, wie sie sich selbst erwischt hat, unaufmerksam zu sein und wie sie die Situation mit ihrer 2-jährigen Tochter reflektiert.
Bindungsorientierte Großeltern
Wenn Paare Eltern werden, werden Eltern Großeltern. Das Familiengefüge verschiebt sich, Menschen tauchen in eine neue Aufgabe ein, in andere Herausforderungen und in eine andere Position im Familiensystem. Für uns als Eltern ergeben sich neue Herausforderungen: Nicht nur, weil wir nun Eltern sind und in unsere neue Aufgabe hinein wachsen. Sondern auch, weil wir auf einmal eine andere Position unseren Eltern gegenüber einnehmen und es manchmal für diese schwierig ist, in der neuen Situation an zu kommen, loszulassen und den neuen Platz zu finden. Großeltern zu sein ist anders, als Eltern zu sein.
Was sich Eltern von Großeltern wünschen
Was wir uns von Großeltern wünschen, ist eigentlich so einfach und doch so schwer: Wir wünschen uns Unterstützung, aber keine Übergriffigkeit. Wir wünschen uns Tipps, ohne Rat“schläge“. Wir wünschen uns praktische Hilfe und anpackende Hände ohne das Gefühl zu bekommen, den Alltag selbst nicht ausreichend oder nicht gut bewältigen zu können. Wir wünschen uns ein Schulterklopfen ohne hochgezogene Augenbraue. Wir wünschen uns, dass unsere Ideen und Gedanken davon, wie unser Kind aufwachsen soll, ihre Wünsche und Gedanken sind.
Wenn wir an uns selbst denken, wissen wir, wie schwer solche Wünsche sind. Und wie schwer es uns selbst oft fällt, genau so zu sein und zu handeln anderen gegenüber. Und dennoch wünschen wir es uns jetzt und heute. Denn mit dem Eintritt in das Elternsein hat eine neue Zeit begonnen für uns, eine neue Zeitrechnung, eine neue Verantwortung. Nun sind wir es, die die Last der nächsten Generation auf unseren Schultern tragen und den Wunsch nach einer guten Zukunft für und mit unseren Kindern. Und genau dafür wollen wir alles geben und wünschen genau das von anderen.
Was Eltern seit jeher wünschen
Was wir manchmal übersehen: Unsere Eltern wollten sehr wahrscheinlich das Beste für uns – wenn ihr Weg auch anders aussah. Weil sie in einer anderen Gesellschaft lebten und für eine andere Zukunft erzogen haben. Eine, die schon wieder Vergangenheit ist. Diesen Gedanken sollten wir im Hinterkopf bewahren, wenn wir negativ über die Gedanken und Wünsche der Großeltern denken. Es hat sich viel geändert und Elternschaft heute ist anders als Elternschaft damals. So, wie wahrscheinlich auch ihre Elternschaft sich schon unterschieden hat von denen ihrer Eltern. Wir gehen voran, mit jeder Generation einen Schritt weiter. – Zum Glück, denn heute wissen wir, welche Fehler auf dem Weg der Vergangenheit liegen.
Wir wissen aus der Bindungsforschung, wie wichtig andere Wege heute sind und dennoch fällt uns schwer, andere Wege zu gehen. – Obwohl wir Eltern in unserer Generation es sind, die über das Wissen verfügen: die Elternzeitschriften lesen, Blogs, Artikel und Ratgeber. Viele von uns sind so fortgebildet in Hinblick darauf, wie Elternschaft sein sollte und doch fällt es auch uns oft schwer. Und noch viel schwerer fällt es vielleicht der Generation vor uns, die nicht beständig liest und erfährt, wie und warum heute anders gelebt wird. Die sich fragt: Hab ich denn damals alles falsch gemacht, wenn es heute anders gemacht wird? Und der es vielleicht noch viel schwerer fällt, über die eigenen Schatten der Vergangenheit zu springen. Und vielleicht nicht mal weiß, wie.
Gemeinsam gehen
„Wenn Du etwas wünschst, sprich es aus!“ Manchmal sind wir verleitet, zu denken, dass sich  unsere Wünsche erfüllen, weil sie Wünsche sind. Aber im Zusammensein mit anderen ist es hilfreich, die eigenen Wünsche direkt zu benennen. Das fällt uns nicht immer einfach und manchmal sogar richtig schwer – gerade dann, wenn wir selbst oft erfahren haben, dass unsere Wünsche missachtet oder unsere Bedürfnisse übersehen wurden. Doch jetzt, in Bezug auf unsere Kinder und unsere eigenen erwachsenen Bedürfnisse ist es wichtig, zum Benennen zurückzukommen – oder es zu lernen. zu sagen „Ich brauche…“, „Es hilft mir…“ statt „Du musst…“ oder „Du solltest…“
unsere Wünsche erfüllen, weil sie Wünsche sind. Aber im Zusammensein mit anderen ist es hilfreich, die eigenen Wünsche direkt zu benennen. Das fällt uns nicht immer einfach und manchmal sogar richtig schwer – gerade dann, wenn wir selbst oft erfahren haben, dass unsere Wünsche missachtet oder unsere Bedürfnisse übersehen wurden. Doch jetzt, in Bezug auf unsere Kinder und unsere eigenen erwachsenen Bedürfnisse ist es wichtig, zum Benennen zurückzukommen – oder es zu lernen. zu sagen „Ich brauche…“, „Es hilft mir…“ statt „Du musst…“ oder „Du solltest…“
Manches Mal mag es so sein, dass die neu gebackenen Großeltern all das mitbringen, was wir uns von ihnen wünschen. Dass sie uns genau so unterstützen, wie wir es wollen, dass sie mit ihren Enkelkindern genau so umgehen, wie wir es erträumen. Manchmal aber kann es anders sein und unsere Ideen und Vorstellungen könnten nicht weiter voneinander entfernt sein.
Es lohnt sich, den Weg gemeinsam zu versuchen, auch wenn er anfangs steinig sein mag. Es lohnt sich, zu versuchen, den anderen erst zu verstehen und dann zu erklären, warum wir heute anders leben. Es lohnt sich, weil wir als Eltern uns dieses Miteinander wünschen, weil wir Hilfe brauchen. Und, weil es für unsere Kinder schön ist, in den Großeltern weitere Bindungspersonen zu finden, die sie auf ihrem Weg begleiten. Das Familienleben in einer Großfamilie war nie immer nur rosarot und einfach. „Das Dorf“ war schon immer an vielen Stellen auch ein Zweckverbund. Manchmal ist das Erklären nicht zweckmäßig, sondern wir kommen nur über das Handeln durch zu neuen Ideen und Veränderungen.
Ideen für Großeltern, um ihnen Bindung praktisch zu vermitteln
Das Baby in einer Tragehilfe tragen lassen
Das Baby massieren lassen von Großmutter/Großvater
Ihnen das weinende Baby geben, damit sie es auf dem Arm beruhigen
Ihnen das Baby „übersetzen“: „Schau, jetzt schaut es Dich an und will spielen.“
Ihnen immer wieder vermitteln: Du kannst es nicht verwöhnen.
Manchmal ist das nicht einfach, den Weg gemeinsam zu gehen. Es kann hilfreich sein, Wünsche genau auszusprechen: „Bitte bring uns eine gekochte Suppe vorbei.“ „Du hilfst mir sehr, wenn Du mir aus der Drogerie etwas mitbringst.“ „Es freut das Baby und hilft ihm, eine Beziehung zu Dir aufzubauen, wenn Du es trägst.“ Bindungsorientierte Großelternschaft beginnt genau da, wo auch bindungsorientierte Elternschaft beginnt: Auf Augenhöhe, mit dem Ernstnehmen der Gefühle und Bedürfnisse des anderen. Und dann zu sehen, wie gemeinsam ein guter Weg gefunden werden kann. Das bedeutet, von beiden Seiten ein wenig entgegenzukommen und sich in der Mitte zu treffen. Das bedeutet, Signale zu übersetzen und zusammen nach Lösungen zu suchen. Das bedeutet, den anderen erst einmal anzunehmen und dann zu erklären, wie es heute anders geht. Möglichkeiten aufzeigen, statt Handlungen zu erwarten.
Auf diese Weise können wir nach und nach zusammen kommen, vereint in dem Wunsch nach dem besten für das neue Kind und mit wachsendem Verständnis dafür, dass „das Beste“ heute anders ist als damals.
Es gibt Konstellationen, in denen sehen wir, dass wir keine gemeinsame Lösung finden in der ein oder anderen Sache. In einigen Situationen ist es ausreichend, sich gegenseitig nur zu akzeptieren. Und es gibt Familienkonstellationen, in denen die Differenzen unüberbrückbar sind und es keinen weiteren Weg gibt, als getrennte Wege zu gehen. Das ist in Ordnung. Jede Familie geht ihren Weg. Aber wenn wir uns Unterstützung und Hilfe wünschen, müssen wir uns heute erst einmal zusammen auf den Weg begeben, um ein neues Bewusstsein für Großelternschaft zu entwickeln.
Eure

 Susanne Mierau ist u.a. Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik), Geburtsvorbereiterin, Familienbegleiterin und Mutter von 3 Kindern. 2012 hat sie „Geborgen Wachsen“ ins Leben gerufen, das seither zu einem der größten deutschsprachigen Elternblogs über bindungsorientierte Elternschaft gewachsen ist. Sie ist Autorin diverser Elternratgeber, spricht auf Konferenzen und Tagungen, arbeitet in der Elternberatung und bildet Fachpersonal in Hinblick auf bindungsorientierte Elternberatung mit verschiedenen Schwerpunkten weiter.
Susanne Mierau ist u.a. Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik), Geburtsvorbereiterin, Familienbegleiterin und Mutter von 3 Kindern. 2012 hat sie „Geborgen Wachsen“ ins Leben gerufen, das seither zu einem der größten deutschsprachigen Elternblogs über bindungsorientierte Elternschaft gewachsen ist. Sie ist Autorin diverser Elternratgeber, spricht auf Konferenzen und Tagungen, arbeitet in der Elternberatung und bildet Fachpersonal in Hinblick auf bindungsorientierte Elternberatung mit verschiedenen Schwerpunkten weiter.
vonguteneltern: Bindung ist ein Regenbogen der Möglichkeiten
Für eine gute Bindung musst Du stillen, musst Du Stoffwindeln benutzen, musst Du… Für eine gute Bindung solltest Du feinfühlig auf die Signale Deines Kindes reagieren. Für die einen ist das Tragetuch dabei gut, für die anderen Stoffwindeln, für wieder andere das Abhalten. Das Handwerkszeug für eine gute Bindung kann ganz unterschiedlich aussehen. Darüber habe ich bei Anja hier geschrieben.
vonguteneltern: Interviews gesucht zu „Stillen ist bunt“
Ich habe drei Kinder gestillt und jede Stillgeschichte ist ein wenig anders, hat einen anderen Beginn, ist anders verlaufen, hatte ein anderes Ende – auch zeitlich. Wenn ich mir die Stillgeschichten der Frauen meiner Umgebung ansehe, sehe ich auch hier: Stillen ist immer wieder ganz unterschiedlich. Unter „Stillen ist bunt“ berichtet Hebamme und IBCLC Anja hier davon, wie unterschiedlich das Stillen ist und sammelt verschiedene Stillgeschichten, um zu zeigen: Es gibt nicht den einen weg, sondern viele verschiedene.
„Nein, meins!“ – Ich will genau dieses Spielzeug JETZT!
Zwei Kinder sitzen im Sandkasten, eines von ihnen spielt mit einem kleinen Trichter und lässt den Sand hindurch rieseln in eine kleine Wasserschüssel, wo der Sand sich sogleich mit Wasser voll saugt und zu Matsch wird. Wie hypnotisiert sieht das andere Kind einen Moment zu, steht dann auf, geht hinüber, und reißt den Trichter aus der Hand. Es entsteht ein Streit um den Trichter – beide wollen ihn haben. Aber steht wirklich der Besitz hinter diesem Streit? Eine ähnliche Situation, die sich oft in Kinderzimmern von Geschwistern abspielt: Das kleine Kind sieht dem größeren Geschwisterkind beim Spielen zu, rennt zu ihm, reißt das Spielzeug aus der Hand, rennt weg, spielt kurz damit und wirft es dann achtlos in die Ecke. Was passiert hier?
Das belebte Objekt
Wenn sich Kinder um einen Gegenstand streiten, denken wir oft, dass es um den Besitz geht. Wir denken, das andere Kind möchte dieses andere Ding haben, möchte es besitzen und wir regen dazu an, Sachen zu teilen, weil wir denken, es würde darum gehen, sich einen Gegenstand auszuleihen. Wenn der Gegenstand dann den Besitzer oder die Besitzerin gewechselt hat, ist das Interesse an dem Gegenstand auch oft schon verloren. „Aha, es ging nur darum, den eigenen Willen durchzusetzen!“ sind Eltern dann oft verleitet zu denken. Oft aber geht es, gerade bei Babys und kleinen Kindern, nicht um den Besitz und auch nicht darum, den eigenen Willen durchzusetzen, sondern um die Erfahrung, die dahinter steht. Dieses Wissen, das Verstehen des Kindes, kann verändern, wie wir mit einer solchen Situation umgehen und das Kind betrachten. Und selbst dann, wenn es manchmal um das Besitzen geht, lohnt sich ein Blick auf die wirklichen Gründe dahinter, warum Besitz ein wichtiges Thema für Kinder ist.
Entwicklungsressourcen
Das Kind, das den Trichter haben möchte, sieht das andere Kind, sieht wie es Freude hat bei dem Spiel und dass es damit eine spannende Erfahrung macht. Es sieht, dass das Kind etwas lernt, experimentiert. Genau das möchte es auch: lernen und experimentieren, sich weiter entwickeln, einen Entwicklungsvorteil erwerben. Wie so oft geht es auch hier um Ressourcen, dieses Mal um Entwicklungsressourcen. Es ist also keine böse Absicht des Kindes, es ist kein Machtspiel, sondern ein innerer Entwicklungsdrang, der hinter dem Verhalten steht.
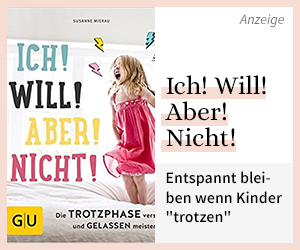 Genau das erkennen wir auch dann, wenn das Kind das Spiel auf einmal beendet und das Spielzeug achtlos zur Seite wirft. Oft passiert das dann, wenn es dieses Spiel, das es gesehen hat, nicht nachahmen kann, wenn es nicht die gleiche Erfahrung damit machen kann wie das andere Kind. Vielleicht, weil es dafür noch zu klein ist, wie oft bei Geschwistern zu beobachten ist: Eben sollte es dieses Spielzeug noch unbedingt sein, nun ist es schon nicht mehr interessant, wo es doch endlich in der Hand gehalten wird.
Genau das erkennen wir auch dann, wenn das Kind das Spiel auf einmal beendet und das Spielzeug achtlos zur Seite wirft. Oft passiert das dann, wenn es dieses Spiel, das es gesehen hat, nicht nachahmen kann, wenn es nicht die gleiche Erfahrung damit machen kann wie das andere Kind. Vielleicht, weil es dafür noch zu klein ist, wie oft bei Geschwistern zu beobachten ist: Eben sollte es dieses Spielzeug noch unbedingt sein, nun ist es schon nicht mehr interessant, wo es doch endlich in der Hand gehalten wird.
Warum nur „teilen“ oft nicht hilft
Das andere oder größere Kind nur zum Teilen aufzufordern, bringt deswegen meist keinen Erfolg in einer solchen Streitsituation: Denn nur durch den Besitz des Gegenstandes wird der eigentliche Wunsch hinter dem „Habenwollen“ nicht erfüllt. Im schlechtesten Fall sind durch die Aufforderung des Teilens zwei Kinder frustriert: Das Kind, das teilen soll (und seinen Besitz abgeben muss, der für das ältere Kind sehr wichtig ist, siehe unten) und das Kind, das mit dem Gegenstand eigentlich nichts anfangen kann.
Hilfreich ist deswegen, wenn wir das andere Kind begleiten im Experimentieren damit oder von Anfang an Alternativen anbieten können bspw. bei Spielsachen, die doppelt vorhanden sind. Eltern, die sowieso mitspielen und im Sandkasten eine eigene Schaufel haben, können ihre Schaufel als Alternative anbieten. Andere Kinder zum Teilen aufzufordern, ist oft schwierig, denn es ist wichtig, auch sie nicht aus ihrem Spiel und ihrer aktuellen Entwicklung heraus zu reißen. Sie brauchen einen geschützten Raum, in dem sie sich in Ruhe beschäftigen dürfen und gerade unter Geschwistern ist es auch wichtig, eigenen Besitz zu haben, der nicht geteilt werden muss.
Besitz
Besitz ist in der Vorschulzeit etwas, das die eigene Position in der Gruppe stärkt oder auszeichnet. Geht es im Wegnehmstreit nicht um das Ausprobieren, kann auch der reine Besitz eine Rolle spielen. Auch hier geht es aber wieder um eine Entwicklungsressource und nicht um eine böse Absicht: Zu sehen, wohin ich gehöre, wie ich mich in der Gruppe bewege und welche Stellung ich habe. Manchmal nehmen Kinder anderen Kindern Dinge weg, um diese soziale Position zu hinterfragen und auszumachen. Auch dies ist normal und wichtig.
Kreativer Umgang mit Konfliktsituationen
Wie immer in Streitsituationen ist es gut, Kinder auch eigene Möglichkeiten und Lösungen finden zu lassen. Manchmal ist dies nicht möglich, und wir müssen eingreifen, um zu unterstützen. Langfristig ist es hilfreich, den Kindern zu vermitteln, dass nach gewünschten Dingen gefragt werden kann. Auch hier ist das Vorbildverhalten der Eltern wieder wichtig: Nehmen wir Dinge einfach aus der Hand oder fragen oder bitten wir zuvor?
Teilen ist ein wichtiger Meilenstein der Entwicklung, aber das freiwillige Teilen erwerben Kinder erst im Laufe der Zeit – es ist, wie viele andere Dinge, eine Frage der Entwicklung.
Deswegen ist es so wichtig, Kinder gut zu begleiten, sie anzuregen, aber nicht zu bestimmen. Wir können ein „gleich“ anbieten, ein „ausleihen“ oder auch einfach vermitteln: Es ist vollkommen in Ordnung, dass Du dieses Ding nicht teilen möchtest, wenn es so wichtig ist. Wir können erklären, dass beispielsweise nicht teilbare Dinge nicht auf den Spielplatz mitgenommen werden, um Konflikten vorzubeugen. Und wir können selber Vorbild sein im Teilen und dem Umgang mit eigenen Dingen, gerade wenn ein Kind etwas von uns Erwachsenen „einfach“ wegnimmt.
Betrachten wir solche Streitsituationen also wohlwollend einmal durch die Augen der Kinder. Dann wird uns klar, dass hinter solchen Streitsituationen keine böse Absicht steckt, kein Fehlverhalten und keine „schlechte Erziehung“, sondern dass sie vollkommen normal und wichtig sind für die kindliche Entwicklung. Und mit diesem Wissen wird es schon leichter.
Eure
Unser Weg mit einem Schreibaby – „Meine Tochter brauchte gefühlt immer mehr von allem: mehr Milch, viel mehr Nähe“
Schreibabys, Babys mit starken Bedürfnissen, High Need Babys – noch immer sind diese Themen oft mit Scham besetzt, es gibt viele Vorurteile und falsche Informationen. In der Reihe „Unser Weg mit einem Schreibaby“ wollen wir dieses Thema aus der Nische holen, Menschen sensibilisieren und betroffene Eltern unterstützen.
Hier berichtet Stephanie über ihren Weg mit einem „Schreibaby“: Ein Baby, das immer etwas mehr brauchte von allem. Wenn Du über Deine Erfahrung berichten möchtest, schreib an [email protected]
1. Stephanie, Deine Schwangerschaft startete nicht ganz so, wie es bei den meisten anderen. Welche Hindernisse musstet Ihr am Anfang überwinden?
Ja das stimmt, nach einer langen Kinderwunschzeit mit einigen Steinen, startete meine Schwangerschaft mit Blutungen. Wir hatten die erste Zeit permanent Angst dieses kleine Wunder zu verlieren.
2. Nach dieser schweren Zeit, ging es aber glücklicherweise ganz anders weiter: Wie hast Du die restliche Schwangerschaft und Geburt erlebt?
Die Schwangerschaft war schön und ich hatte wenig Probleme. Wir freuten uns unendlich auf unsere Tochter. Ich sang ihr jeden Abend ein Schlaflied vor und mein Mann cremte den Bauch ein. Als es langsam Richtung Ende der Schwangerschaft ging, wurde ich nervös weil sich meine Tochter nicht drehen wollte. In der 37. SSW sagte der Arzt mir, das ich sie auch in Steißlage bekommen könnte und ich beschäftigte mich gar nicht mehr wirklich mit einem Kaiserschnitt. Für mich bzw. uns war auch völlig klar, dass sie nicht geholt werden sollte, sie sollte sich auf den Weg machen wenn sie soweit ist. Die Wehen kamen und wir gingen, rückblickend betrachtet vielleicht zu früh, ins Krankenhaus. Dort ließ man uns eigentlich in Ruhe. Ich und mein Mann arbeiteten uns gemeinsam durch die Wehen. Durch die Steißlage wird in die Geburt am Anfang ja kaum eingegriffen weil die Kraft am Ende zur Geburt des Kopfes benötigt wird. Letztendlich verbrachten wir die nächsten über 30 Stunden in diesem Krankenhaus mit Wehen, die mal ganz regelmäßig aller 5 Minuten kamen aber auch Zeiten wo nur aller 10-15 Minuten eine Wehe kam. Irgendwann war ich so am Ende, weil ich auch permanent brechen musste, dass ich mir nicht mehr vorstellen konnte mein Kind normal zu gebären. Ich bat um einen Kaiserschnitt, meine Tochter sollte somit am selben Tag wie mein Papa geboren werden. Für mich war der Kaiserschnitt eine Erlösung, nicht das was ich wollte aber doch irgendwie richtig. Meine Tochter war perfekt, mein Mann hielt sie für mich und ließ sie auch die erste Stunde nicht aus den Augen und Armen, auch zu jeglichen Untersuchungen begleitete er sie. Dann kamen die beiden mit der Hebamme zu mir und das Stillen klappte vom ersten Moment an und es war die ganz große Liebe. Durch die tolle Vorbereitung im Geburtsvorbereitungskurs unserer Hebamme, wussten wir genau was wir beim Stillen beachten mussten und was erste Hungeranzeichen des Babys sind.
3. Als Ihr nach dem Kaiserschnitt dann nach Hause kamt: Wie ging es Dir und Euch? Wie ist Deine Tochter bei Euch zu Hause angekommen?
Uns ging es hervorragend, natürlich hatte ich Schmerzen aber wir hatten eine tolle Hebamme, die uns schon im Geburtsvorbereitungskurs sagte, dass das Wochenbett fürs Bett gedacht ist, dass man die erste Woche wirklich nur im Bett bleiben sollte und der Mann möglichst am Anfang seine Elternzeit nehmen soll. Durch den Kaiserschnitt konnte ich am Anfang wirklich nicht so gut Laufen und so übernahm mein Mann das Spazieren. Zu diesem Zeitpunkt konnte er noch stundenlang mit unserer Tochter im Kinderwagen spazieren gehen. Die Nächte waren von Anfang an durchstillt. Sie zeigte, wie schon im Krankenhaus, die ersten Hungeranzeichen und so könnten wir prompt reagieren. Sie ließ sich nicht ablegen, geschweige den weglegen aber wir genossen es und sie schlief abwechselnd auf mir oder meinem Mann tagsüber. Nachts versuchte ich sie immer in ihr Beistellbett zu legen aber diese 10 cm Abstand gefielen ihr nicht. Nichts was ich für den Anfang als ungewöhnlich bezeichnen würde. Unser Stillen klappte super gut, so als ob wir beide noch nie etwas anderes gemacht hätten. Am Anfang war alles „normal“.
4. Das erste Anzeichen dafür, dass Deine Tochter anders als andere Dir bekannte Babys war, hast Du also am Stillen festgemacht?
Ja sie trank gut aber auch gefühlt permanent und irgendwann um die 8. Woche fing sie an meine Brust anzuschreien. Ab diesem Zeitpunkt fand sie nur, wir nennen es liebevoll „schuppelnd“ also quasi wackelnd, in den Schlaf. Stundenlang hopste ich auf dem Pezziball, trugen wir sie auf dem Arm im Fliegergriff oder gingen mit dem Tragetuch spazieren, was aber nicht selten darin endete, dass wir sie versuchten abzulegen und letztendlich wachte sie doch immer auf. Irgendwann stillte sie nur noch im Liegen, also musste ich unterwegs immer mit ihr zum Wickeltisch gehen und sie so stillen, anders funktionierte es einfach nicht, auch zu Hause stillten wir nur noch so. Sie zeigte keine frühen Hungeranzeichen mehr sonder schrie immer sofort los und ließ sich kaum beruhigen.
5. Wann wurde bei Euch der Alltag schwieriger und wie gestaltete er sich?
So ungefähr 2 Wochen bevor mein Mann wieder arbeiten musste, sie musste immer bewegt werden. Stehen bleiben oder Sitzen ging nicht, Stillen ging nur noch im Liegen. Ohne meine Hebamme, die mich dazu ermutigte durchzuhalten und auch eventuelle Blockaden abklären zu lassen, hätte ich wahrscheinlich viel eher aufgehört zu Stillen. So haben wir bis 2,5 zum Einschlafen gestillt und erst in diesem Sommer, auf meinen Wunsch hin, aufgehört. Mein Mann schlief ein Jahr auf dem Sofa weil er früh immer extrem zeitig auf Arbeit pendeln musste und meine Tochter nachts permanent aufwachte und schrie und sich manchmal einfach durch nichts beruhigte oder stundenlang wach war oder durchstillte. Sie fuhr nicht gern Auto, ich sang manchmal gefühlt um mein Leben, weil dass das Einzige war, was sie im Auto etwas beruhigte. Leider dachten wir zu diesem Zeitpunkt auch, dass wir die 25 km zu unseren Eltern jedes Wochenende fahren müssten. Ich hatte das Gefühl nicht zu genügen und wir hatten immer wieder das Gefühl etwas falsch zu machen, etwas Entscheidendes zu übersehen. Meine Tochter brauchte gefühlt immer mehr von allem, mehr Milch, viel mehr Nähe. Am schlimmsten waren die Stimmen von außen, die uns wirklich nur helfen wollten aber mich eigentlich nur verunsicherten und das war für uns nicht wirklich besser. Am Anfang beruhigte mich meine Hebamme noch weil sie noch unter 3 Monaten war aber irgendwann sagte auch sie, dass wir das beim Orthopäden überprüfen lassen sollten und dieser fand dann Blockaden, unter anderem auch im Halswirbel, das sogenannte KISS (Kopfinduzierte Symmetriestörung) Ich kann nicht sagen ob es ihr wirklich half, sie blieb trotzdem immer unzufrieden, wollte nur auf den Arm und selbst im Tragetuch gefiel es ihr nicht wirklich und um jeden Schlaf mussten wir kämpfen. Sie ist nie einfach mal eingeschlafen. Mit einem Jahr sollte sie eigentlich in die Krippe kommen aber wir entschieden uns sie zu einer Tagesmutter zu geben, bei ihr konnte sie sich langsam eingewöhnen und auch an Mittagsschlaf ohne Stillen gewöhnte sie sich bei ihr durch viel Nähe. Jetzt ist sie mittlerweile im Kindergarten und es funktioniert wunderbar. Eine Krippe wäre trotzdem nichts für sie gewesen, sie mochte noch nie große Menschenmengen.
6. Wie hat Euer Umfeld auf Eure viel weinende Tochter reagiert?
Sie haben versucht eine Lösung zu finden. Entweder man dachte sie hat Bauchweh (Nummer 1 Grund) oder es war das Stillen oder wir waren einfach zu weich und hätten sie abhärten müssen. Das kam für uns nicht in Frage und darauf haben wir uns heute erst ein High Five gegeben, weil wir zum Glück diese Hebamme hatten, die uns auf den Bedürfnisorientierten Weg gebracht hat. Heute finde ich es einfach furchtbar, dass niemand einfach dieses Kind so akzeptiert hat wie es war und so konnte auch ich es lange nicht akzeptieren. Auch unsere Vorstellungen passten nicht mit der Realität zusammen. Wir haben vor der Geburt viel Sport zusammen gemacht und nach der Geburt dachten wir, wir können sie einfach mitnehmen und sie mit dem Kinderwagen in eine Ecke stellen und trainieren, weil ging ja bei anderen auch. Viele haben uns nicht verstanden, weil gefühlt alle Kinder in unserer Umgebung entspannt und zufrieden waren. Ein totaler Tiefpunkt war eine Familiengeburtstagsfeier, da war ein anderes gleichaltriges Baby und das guckte nur rum und unsere Tochter schrie im Fliegergriff. Eigentlich hätten wir einfach gehen sollen aber wir dachten halt, irgendwie muss der Alltag doch normaler werden. Auch wenn Freunde zu Besuch waren schrie sie und ich musste mit ihr in einen ruhigen Raum gehen. Ehrlich gesagt, hätte ich vor meiner Tochter, auch gedacht, dass die Eltern da wohl was falsch machen.
7. Nun ist sie schon 3 Jahre alt. Wie ist Euer Alltag heute?
Das Thema Schlaf ist weiterhin ein Empfindliches, wenn in unserem Viertel irgendwo ein Kind weint, denken wir prompt, dass es unseres ist. Sie findet auch heute noch sehr schlecht in den Schlaf und wacht häufig auf, es ist aber schon viel besser wie früher. Außerdem ist sie so ein emphatischer und glücklicher kleiner Mensch. Sie geht so offen auf Leute zu und hat schon früh morgens ein Lächeln auf den Lippen. Ich würde trotzdem sagen, dass sie auch heute noch herausfordernder ist als andere Kinder, diese gewisse Unzufriedenheit hat sie auch heute noch. Sie braucht einfach ein bisschen mehr von allem. Aber durch vieles Lesen verstehen wir unsere Tochter, sie ist einfach etwas ganz besonderes und hat uns in unserer Entwicklung so viel weiter gebracht! Ich bzw. wir haben so viel auch über uns gelernt aber wir haben auch wirklich ein kleines Babytrauma davon getragen.
Weitere Erfahrungsberichte gibt es hier:
Unser Weg mit einem Schreibaby – Julia von familiengarten berichtet
Unser Weg mit einem Schreibaby – Nina, ihr Baby und Reflux
Unser Weg mit einem Schreibaby – Sarah und ihr Weg nach traumatischer Geburt
Der Moment des ersten Kennenlernens
Wer ein Kind in sich trägt, lernt es über die Monate kennen. Kleine Streckbewegungen, Tritte gegen eine Hand, das Streicheln über den Bauch, das beruhigt. Wir gehen schon vor der Geburt in Beziehung mit dem kleinen Menschen, der in uns wächst. Und dennoch gibt es diesen einen Moment, in dem sich Eltern und Kind zum ersten Mal in die Augen blicken, in dem zum ersten Mal die kleinen Gesichtszüge betrachtet oder befühlt werden. Der magische Moment des richtig bewussten Kennenlernens.
Hier sind wir zwei nun…
Zwei Handvoll Mensch liegen im Arm, so warm und leicht und schwer zugleich. So leicht als Mensch und so schwer als Verantwortung. Von nun an ist da dieser Mensch in Deinem Leben und Du bist Mutter oder Vater. Das erste Mal das eigene Kind zu halten, ist besonders. Mit großen Augen blickt es den Menschen gegenüber an, so ruhig und besonnen. Es scheint jede Besonderheit des Gesichts aufzunehmen, es abzugleichen, zu erkennen. Und auch wir auf der anderen Seite blicken in dieses kleine Gesicht und denken: „Ach so siehst Du aus, herzlich willkommen.“ Ein Kennenlernen beginnt, eine Art Blind-Date: Was bringst Du wohl mit in unsere Beziehung, in unser Leben? Was wirst Du lieben, was wirst Du ablehnen? Welches Temperament hast Du und welche wird Deine Lieblingsfarbe werden? In den nächsten Jahren werden wir zusammen wachsen, uns aufeinander abstimmen und auch immer wieder mit verschiedenen Meinungen aufeinander treffen. Es wird so schöne Momente geben wie diesen und harte, schwere Stunden. Großes Glück und große Sorgen. Aber in diesem einen Moment zählt nur, sich anzublicken. Alles andere kommt später.
In all den Jahren habe ich viele Erfahrungen mit meinen Kindern gemacht und doch erinnere ich mich an diesen einen Moment, an dem ich jedes Kind so wirklich bewusst und in Ruhe wahrgenommen habe. In dem die Zeit um uns verschwand und wir ganz bewusst eintauchten in das Kennenlernen. Uns gegenüber waren und anblickten. Jedes Mal wieder war es ein magischer Moment. Ein Blick des Erkennens und gleichzeitig des neu Kennenlernens: „Hier sind also wir beide. Lass uns sehen, wohin die Reise zusammen geht.“
Wenn das Kennenlernen warten muss…
Manchmal ist es nicht möglich, das Baby sofort in die Arme zu nehmen und anzublicken. Manchmal stehen andere Dinge im Vordergrund: das Baby muss versorgt werden oder die Mutter braucht dringend medizinische Versorgung. Manchmal muss dieser erste Moment warten. Oft gibt es andere liebevolle Hände, die das Baby aufnehmen und Augen, die es neugierig und voll Gefühl anblicken. Nicht nur die gebärenden Mütter erleben diesen Augenblick des Kennenlernens. Und auch, wenn es manchmal schwer ist, anzunehmen, dass dieser Augenblick verschoben werden muss, ist ein Verschieben möglich: Der magische Moment des Kennenlernens kann nachgeholt werden.
Es ist gut und schön und kann einige Dinge erleichtern, wenn das frühe Bonding direkt nach der Geburt stattfinden kann, aber Eltern haben auch später Zeit, mit dem Kind zu bonden, an eine Beziehung anzuknüpfen, die ja bereits im Mutterleib begonnen wurde. Wir müssen uns in einer ohnehin schwierigen Situation nicht noch zusätzlich unter Druck setzen (lassen), wenn es wichtige Gründe gibt, die dagegen sprechen. Denn diese Gründe sind auch Teil der Bindungsbeziehung: Wir versorgen uns oder lassen uns versorgen, um dann für das Kind sorgen zu können. Wir lassen das Baby von anderen versorgen und geben es zum Überleben, für seinen Schutz, in die Hände von Fachleuten, die es medizinisch versorgen mit dem, was es genau jetzt braucht. All das hat auch mit Bindung zu tun und mit der Sorge gegenüber dem Kind. All das ist auch kümmern. All das ist wichtig.
Kennenlernen kann später stattfinden. In einem ruhigen Moment zusammen im Bett oder zusammen im Bad. Die Hebamme Brigitte Meisner hat hierfür das Babyheilbad als Anregung zur Aufarbeitung negativer Geburtserfahrungen entwickelt, bei dem eine Geburt noch einmal anders nacherlebt wird. Und auch dann, wenn es noch einige Wochen dauert, weil die Mutter seelisch von der Geburt und den Ereignissen drum herum sehr belastet ist, ist noch Zeit für das Kennenlernen und Verbinden. Bindung passiert im Alltag, in den kleinen Momenten und ist ein langer Prozess.
Eure

 Susanne Mierau ist u.a. Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik), Geburtsvorbereiterin, Familienbegleiterin und Mutter von 3 Kindern. 2012 hat sie „Geborgen Wachsen“ ins Leben gerufen, das seither zu einem der größten deutschsprachigen Elternblogs über bindungsorientierte Elternschaft gewachsen ist. Sie ist Autorin diverser Elternratgeber, spricht auf Konferenzen und Tagungen, arbeitet in der Elternberatung und bildet Fachpersonal in Hinblick auf bindungsorientierte Elternberatung mit verschiedenen Schwerpunkten weiter.
Susanne Mierau ist u.a. Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik), Geburtsvorbereiterin, Familienbegleiterin und Mutter von 3 Kindern. 2012 hat sie „Geborgen Wachsen“ ins Leben gerufen, das seither zu einem der größten deutschsprachigen Elternblogs über bindungsorientierte Elternschaft gewachsen ist. Sie ist Autorin diverser Elternratgeber, spricht auf Konferenzen und Tagungen, arbeitet in der Elternberatung und bildet Fachpersonal in Hinblick auf bindungsorientierte Elternberatung mit verschiedenen Schwerpunkten weiter.
Radiobeitrag: Autogeburt
Erinnerst Du Dich noch an unseren Aprilscherz „Die Autogeburt„? Gerade ist ein Radiobeitrag zu diesem Thema hier erschienen und nicht nur unser Aprilscherz wird erwähnt, sondern das ganze Thema wird behandelt und es kommen Familien zu Wort, die eine Autogeburt erlebt haben. Hörenswert.