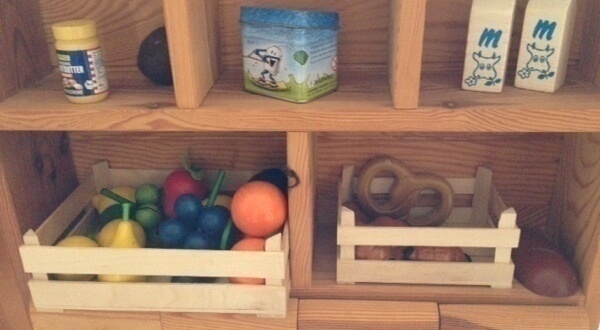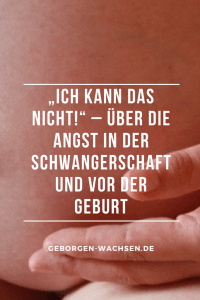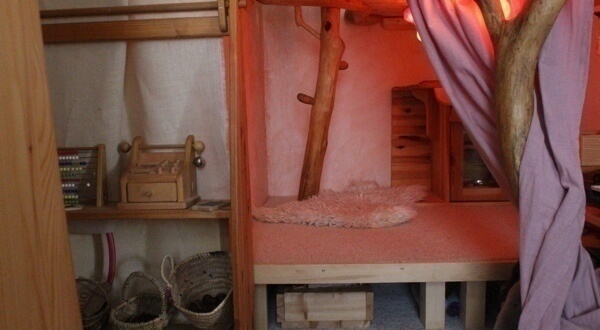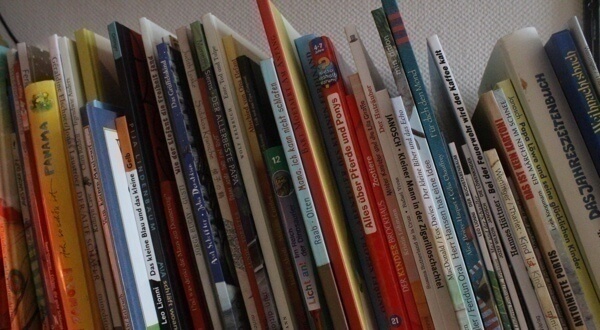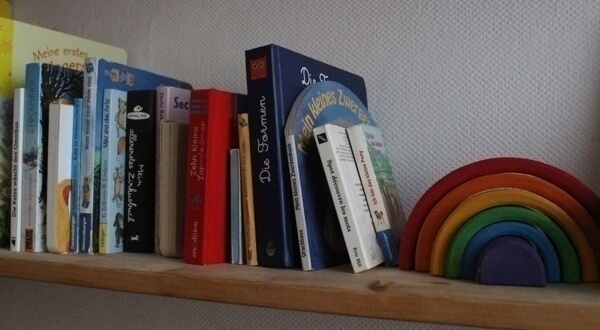Momentan gibt es in der aktuellen ELTERN-Zeitschrift eine Reihe unter dem Titel „Väter 2014“. Diesmal geht es darum, wie Männer heute Schwangerschaft und Geburt erleben. An einigen Stellen konnte ich diesmal nur den Kopf schütteln: Darin findet sich ein Interview mit Dr. Wolf Lütje, Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe im Hamburger Amalie-Sieverking-Krankenhaus. Dr. Lütje erzählt darin, dass er einen Geburtsvorbereitungskurs für Männer gibt, in dem er ihnen wichtige Botschaften für die Geburt vermittelt. Die erste davon lautet:
Du hast es während der Geburt mit einer Frau zu tun, die du nicht kennst.
Botschaft Nummer zwei ist:
Es gibt für dich nichts zu tun. Man muss den Männern die Erwartungen nehmen. Dann gehen sie entspannter in den Kreißsaal. Es kann nämlich sein, dass alles, was ein Mann im Geburtsvorbereitungskurs gelernt hat, auf einmal bedeutungslos wird – weil die Frau gar nicht berührt werden will, weil sie ihm den Waschlappen aus der Hand schlägt, mit dem er ihr die Stirn kühlen möchte, oder weil sie den Becher Wasser in die Ecke pfeffert.
Mit Botschaft Nummer drei und vier finde ich wichtig, würde sie jedoch noch etwas weiter ausführen. Dr. Lütjes Nachrichten sind:
Der Mann soll sich vor den Bildern schützen. […] Es ist gut, wenn du dich um deine Frau kümmerst, aber noch besser ist es, wenn du dich um dich selbst kümmerst.
Zum Begriff „Partner während der Geburt“
Seit 2009 bin ich selber Geburtsvorbereiterin. Ich habe im Geburtshaus Kurse für Paare gegeben und Paare in Einzelgesprächen auf die Geburt vorbereitet. Ich spreche an dieser Stelle bewusst von „Paaren“, denn ich habe bereits Regenbogenfamilien betreut oder auch Frauen, die als Partner nicht ihren Lebenspartner, sondern eine Freundin mitnahmen. Für sie alle gelten die Empfehlungen, die ich Partnern in meiner Arbeit mit auf dem Weg gebe. Unabhängig davon, ob nun der Begleiter bei der Geburt ein Mann, eine Frau, eine Freundin oder irgendjemand anderes Nahestehendes ist.
Partnerschaft unter der Geburt
Nun also zum Kern dieses Artikels: Gedanken zu den „wichtigen“ Botschaften von Dr. Lütje. Haben wir es unter der Geburt mit einem anderen Menschen zu tun? Die Geburt ist ein einschneidendes Ereignis im Leben – und zwar für alle Beteiligten. Ein Mensch wird geboren, Eltern werden geboren, ein Paar wird zu einem Elternpaar. Durch und während der Geburt verändern sich Dinge. Und gebärende Frauen begeben sich in einen Zustand, den sie – zumindest beim ersten Kind – noch nicht erlebt haben. Viele Frauen berichten nach einer Geburt davon, welch unglaubliche Kräfte sie in sich mobilisieren konnten, dass sie eine bisher ungeahnte Kraft verspürten, dass sie über ihre Grenzen hinaus gegangen sind. Ja, gebärende Frauen lernen sich unter der Geburt neu kennen. Und natürlich lernt auch der Partner die Frau dadurch auf eine neue Weise kennen.
Was jedoch eher dem Klischee aus dem Film nahe kommt sind Frauen, die immer lieb und freundlich sind und unter der Geburt auf einmal mit Gegenständen um sich werfen, schmutzige Schimpfwörter benutzen und den Partner verfluchen. Ja, es kommt vor, dass Schimpfwörter benutzt werden, es gibt negative Gedanken und auch ruppige Bewegungen, aber unter der Geburt gibt es normalerweise keinen Persönlichkeitswechsel.
Es ist falsch, Partner in den Glauben zu versetzen, die Frau würde unter der Geburt vielleicht eine ungehaltene Fremde werden. Es ist falsch, weil es schlichtweg nicht stimmt, aber auch, weil natürlich auch negative Emotionen zum Ausdruck kommen können, aber sie nicht einer vollkommen anderen Person entspringen. Frauen können unter der Geburt emotional kräftiger sein als sonst, aber in ihrem persönlichen Temperamentsrahmen. Und Kraft wird unter der Geburt benötigt. Die Energien, die frei werden, sollten eher als unterstützend und bestärkend wahrgenommen werden.
Wir sind und bleiben die Menschen, die wir sind. Auch unter der Geburt. Vielleicht kommt eine Seite zum Ausdruck, die wir sonst weniger in uns tragen. Oder wir erkennen auch Neues in uns. Aber wir werden keine Fremden. Und unter der Geburt wird der Partner auch deswegen nicht fremd, weil man sich auf ihn einstellt, weil man bei ihm ist. Man stellt sich aufeinander ein. Man durchlebt gemeinsam diese Geburt, die auch beide auf ihre Weise verändern wird.
Was Partner unter der Geburt leisten
Machen wir uns nichts vor: Gebären muss nun einmal die Frau. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber sie ist nicht allein und es stimmt nicht, dass ein Partner nichts für sie tun kann. Gerade bei einer Geburt im Krankenhaus kann der Partner nämlich von besonders großer Hilfe sein.
Was viele Paare nicht ahnen ist der Umstand, dass sie in der Eröffnungsphase lange Strecken auf sich gestellt sind. In dieser Zeit kommt in vielen Krankenhäusern ab und zu eine Hebamme vorbei, um nach dem Voranschreiten der Geburt zu sehen, aber sie sitzt nicht im gleichen Zimmer. Das ist in den meisten Fällen auch gut so, denn hierdurch kann die Frau zu sich kommen, wird nicht abgelenkt. Das Großhirn wird nicht aktiviert, was besonders Michel Odent immer hervor hebt. Sie kann ganz bei sich sein und auf ihren Körper hören. Doch hier ist es auch gut, jemanden an der Seite zu haben. Klassischerweise lernen Partner im Geburtsvorbereitungskurs wie sie den Rücken der Gebärenden massieren können oder ihr Becken bewegen. Und während die Gebärende unter der Geburt vollkommen richtig ihr Großhirn ausschaltet und damit auch nicht an all die Ratschläge aus dem Kurs denkt, ist da der Partner dabei, der daran denken kann. Der ohne große Gespräche oder Erinnerungen an die soundsovielte Geburtsvorbereitungssitzung ihr den gesüßten Tee reicht, der den Rücken massiert, die Hand hält oder das Becken bewegt. Der sie unterstützt im Atmen, mitatmet und auch einfach darauf achtet, was sie gerade möchte, was ihr Körper ihr sagt und darauf eingeht. Der auf sie und ihre innere Stimme vertraut.
Gebärende brauchen unter der Geburt Ruhe und Zurückgezogenheit. Sie müssen Intimsphäre haben, damit sich die Schließmuskeln entspannen, sich der Muttermund öffnen kann. Und gerade hierfür ist der Partner im Krankenhaus von unschätzbarem Wert: Weiß er um die Bedeutung von Ruhe und Intimsphäre, kann er sich um diese Rahmenbedingungen kümmern, während sich die Gebärende auf die Geburt konzentriert. Er kann Klinikpersonal darum bitten für mehr Ruhe zu sorgen, kann Routinen ablehnen, kann sich auch gegen bestimmte Eingriffe zur Wehr setzen, die vorher gemeinsam als ungewünscht besprochen wurden. Während der Geburt fällt es Frauen nämlich oftmals schwer, solche Entscheidungen zu fällen. Es soll schon einmal – nur vorsichtshalber – ein Zugang an der Hand gelegt werden? Solche (wenn auch nur kurz schmerzhaften) Eingriffe können Frauen aus der Geburtsarbeit wieder heraus holen. Sie sind oft auch schlichtweg nicht notwendig, wenn ein Paar zu einer normalen, spontanen Geburt in die Klinik kommt. Ebenso verhält es sich mit einem Einlauf zur Darmentleerung. In einem guten Fall werden diese Routinen im Geburtsvorbereitungskurs angesprochen und das Paar kann auf dieser Basis gemeinsam besprechen, was sie sich wünschen und was nicht – und für was der Partner unbedingt einstehen soll.
Natürlich können Geburtsbegleiter und Partner nicht die Geburtsarbeit abnehmen. Sie können auch die Schmerzen nicht wegnehmen. Aber sehr wohl können sie Schmerzen vermindern. Studien belegen, wie sich positiver Körperkontakt auf das Schmerzempfinden auswirkt. Und ja, es gibt Frauen, die unter der Geburt nicht berührt werden möchten. Ina May Gaskin betont, wie sehr das Lachen während der Geburt Erleichterung bringen kann, weil der Betaendorphinspiegel gehoben wird, was Schmerzen betäubt. In ihrem Buch „Birth Matters – Die Kraft der Geburt“ schreibt sie auch, wie das Küssen während der Geburt hilfreich sein kann, um den Schmerz beim Durchtritt des Kindes durch den Geburtskanal zu mindern. Begleiter unter der Geburt können also entscheidend positiv auf die Geburt einwirken, obwohl sie vielleicht in mancher Augen nicht viel tun. Doch wie so oft im Leben gilt auch hier: Qualität ist wichtiger als Quantität. Es kommt nicht darauf an, wie viel ein Partner unter der Geburt macht, sondern dass das, was er tut, das ist, was gerade gebraucht wird.
In einem guten Geburtsvorbereitungskurs sollten die Menschen, die eine Gebärende zur Geburt begleiten, also lernen, wie wichtig die Rahmenbedingungen für eine Geburt sind: Ruhe, Abgeschiedenheit, angenehme Atmosphäre und verständiges Personal. Sie können Handgriffe lernen, die Erleichterung bringen unter den Wehen, wie Rücken- oder Fußmassagen. Und sie können erklärt bekommen, wie sonst positiv auf Schmerzen eingegangen werden kann durch Körperkontakt, Berührungen, durch Küsse, durch gemeinsames Lachen, durch gemeinsames Tönen und positive Gedanken. Und natürlich sollten sie auch wissen, dass die Gebärende unter der Geburt im Vordergrund steht und man weder erwarten kann noch sollte, dass sie sich um die Begleitung kümmern kann.
Begleitung zur Geburt – eine wohl überdachte Wahl
Was vorher auf jeden Fall – und darin stimme ich mit Dr. Lütje überein – geklärt werden muss, ist der Umstand, ob der Lebenspartner wirklich die Geburt begleiten möchte. Heutzutage wird das oft angenommen oder gar voraus gesetzt. Doch ist es wichtig, das vorher zu besprechen. Manche Partner haben Schwierigkeiten, die Frau unter der Geburt zu sehen. Die Gründe dafür können sehr individuell sein und sollten auf jeden Fall immer beachtet werden.
Ist vorher bekannt, dass der Lebenspartner nicht bei der Geburt dabei sein kann oder möchte, kann eine Alternative gesucht werden. Auch eine gute Freundin oder Doula kann zur Geburt hinzu gezogen werden. Von unschätzbarem Wert ist eine Beleghebamme. Wichtig ist, dass der Begleiter oder die Begleiterin auf das Ereignis vorbereitet ist und die Abläufe kennt. Es muss in der Geburtsvorbereitung beispielsweise erwähnt werden, dass unter der Geburt auch Stuhl bei der Frau abgehen kann, wenn das Kind durch den Geburtskanal tritt. Sind solche Fakten bekannt, muss sich weder die Frau dafür schämen (oder gar verhalten, was sich auf den Fortgang der Geburt negativ auswirken kann), noch werden Partner davon überrascht. Hier ist, was Dr. Lütje ebenfalls hervorhebt, die Position des Partners so wichtig: Die begleitende Person muss ja nicht direkt das Durchtreten des Kopfes sehen. Ein Platz im Rücken der Gebärenden, um sie zu halten und zu stützen, zum Beispiel bei einer Geburt auf dem Gebärhocker oder im Stand, ist für viele Begleiter eine sehr gute Position.
Fazit: Es gibt viel zu tun für Menschen, die Gebärende begleiten
Wer eine Gebärende begleitet, kann viel für sie tun. Es muss nicht der Lebenspartner sein, der sie zur Geburt begleitet, aber eine vertraute Person ist eine wunderbare Unterstützung, wenn eine Frau im Krankenhaus ihr Kind gebären möchte. Geburtspartner können zwar keine Schmerzen abnehmen und auch nicht das Kind gebären, aber es gibt zahlreiche hilfreiche Dinge, die sie tun können. Wie und was möglich ist, können sie vorher in einem Geburtsvorbereitungskurs erklärt bekommen. Hebammen und Geburtsvorbereiterinnen sind speziell dafür ausgebildet, Kurse anzubieten, in denen es nicht nur um die medizinischen Fakten zur Geburt geht, sondern um das eigentlich wichtige: Wie eine gute Geburtsatmosphäre geschaffen werden kann und wie die Gebärende auf natürliche Weise unterstützt werden kann. Ich persönlich würde daher immer zu einem Besuch bei einer Geburtsvorbereiterin oder Hebamme raten und nicht zu einem Kurs, der von Ärzten in der Klinik geleitet wird, da deren eigentliches Berufsfeld ein anderes ist.