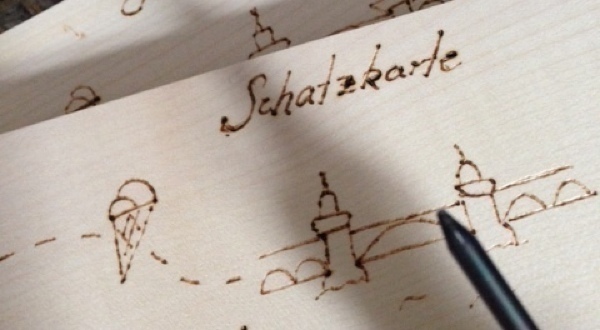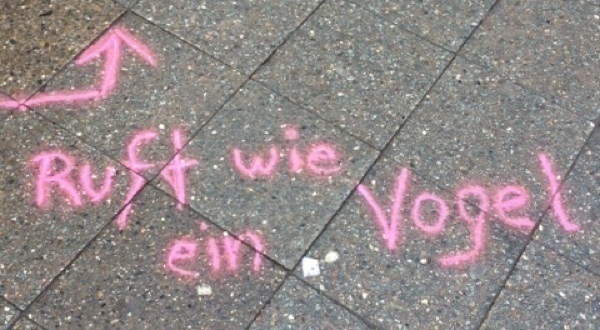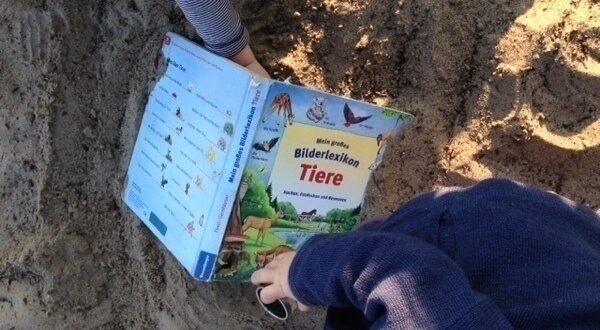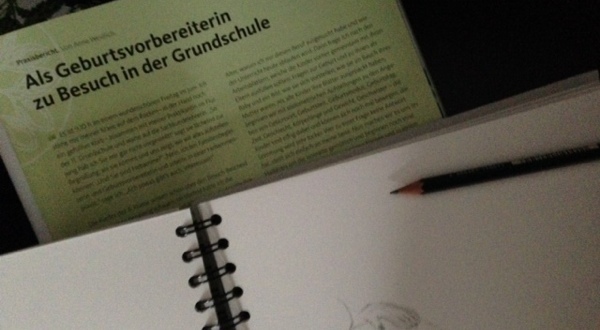Immer wieder ist es ein groß in den Medien diskutiertes Thema: Stillen in der Öffentlichkeit. 2011 gab „Big Bang Theory“-Star Mayim Bialik Anlass zur Diskussion darum, ob Stillen in der Öffentlichkeit in Ordnung sei oder nicht und – in ihrem Fall – bis zu welchem Alter des Kindes das nun überhaupt noch richtig sei. Sie hatte ihren dreijährigen Sohn in der U-Bahn gestillt. Als Mutter von zwei Kindern und Familienbegleiterin kenne ich diese Diskussion um das öffentliche Stillen nur zu gut. Meine Tochter habe ich bis zum Alter von 2 Jahren gestillt – durchaus auch in der Öffentlichkeit – und meinen 16 Monate alten Sohn stille ich auch noch nach Bedarf. Doch oft ist es gar keine Frage des Alters, sondern generell des Umstandes: Kann und soll man in der Öffentlichkeit stillen? Denn ganz ehrlich gesagt wurde ich mit beiden Kindern nicht erst schief angeschaut beim Stillen als sie ein bestimmtes Alter erreicht hatten, sondern auch schon, als sie noch ganz klein waren. Stillen in der Öffentlichkeit erregt immer wieder die Gemüter – aber warum eigentlich?
Stillen ist Nahrungsaufnahme
Ich fahre in der Berliner S-Bahn. Ein Mann steigt ein und verzehrt einen Döner mit nicht geringer Geruchsbelästigung der umstehenden Fahrgäste. Eine Frau gegenüber trinkt einen Kaffee aus einem Pappbecher. Ein Kind sitzt in der Ecke und isst aus einer Tupperdose ein Schulbrot. Auf dem Boden liegen Papierreste, die deutlich erkennen lassen, dass ein früherer Fahrgast Nahrungsmittel einer großen Fastfood-Kette hier zu sich genommen hat. Auf der Straße ist es nicht anders: Menschen laufen mit Käsebrötchen, Nougatcroissants und Brezeln durch die Straßen, trinken Softdrinks auf Glasfalschen. Niemand beschwert sich, schaut mit hochgezogener Augenbraue einen anderen an oder tuschelt hinter vorgehaltener Hand laut. Es ist ein normaler Anblick, dass Menschen in der Öffentlichkeit Nahrungsmittel zu sich nehmen. Wenn ein Baby in einem Einkaufszentrum eine Flasche bekommt, schüttelt niemand den Kopf.
Muttermilch ist die normale Nahrung des Babys und Kleinkindes. Stillverbände fordern heute, dass nicht mehr davon gesprochen wird, dass Stillen Vorteile hätte, denn es geht nicht um Vorteile, sondern darum, dass dies nun einmal die richtige und normale Ernährungsform ist. Wie auch immer versucht wird, Muttermilch künstlich herzustellen, ist es nicht machbar, sie so gesund herzustellen, wie nun einmal Muttermilch ist. Und Muttermilch kommt natürlich in ihrer naturgegebenen Verpackung: der weiblichen Brust. In diesem Sinne hat die Entblößung der weiblichen Brust beim Stillen den einfachen Grund, dem Kind seine normale Nahrung zukommen zu lassen. Stillen ist Nahrungsaufnahme. So wie andere Babys ihre Milch aus der Flasche trinken oder Erwachsene ihr Mettbrötchen in den Mund schieben, ernährt sich das Kind über die Brust. Wer das Stillen sexuell konnotiert, hat einfach nicht verstanden, worum es dabei geht. Zudem wird dieser sexuelle Aspekt allein durch den Betrachter in die Stillsituation eingebracht: Weder Mutter noch Kind vollziehen eine sexuelle Handlung wenn sie stillen.
Nahrungsaufnahme verdient angemessene Rahmenbedingungen = kein Stillen auf Toiletten
Gegner des öffentlichen Stillens führen gerne an, dass ja nicht in der Öffentlichkeit gestillt werden müsste, weil es ja Stillräume geben würde oder sich stillende Mütter an einen „diskreten Ort“ zurück ziehen könnten wie eine Toilette. Ja, mancherorts gibt es Stillräume und das kann auch eine gute Alternative sein, wenn Frauen dies wünschen. Häufig allerdings sind diese Stillräume mit Toiletten zusammen gelegt. Und ehrlich: Wer möchte gerne seinem Kind eine Mahlzeit auf einer öffentlichen Toilette anbieten? Wer möchte gerne eine Mahlzeit auf einer öffentlichen Toilette einnehmen? Unabhängig von hygienischen Bedenken und der Geruchsbelästigung und häufig auch einem Mangel an bequemer Sitzposition kann doch niemand ernsthaft einer Mutter mit Kind vorschlagen wollen, sich auf eine Toilette zum Stillen zurück zu ziehen?
Stillen ist eine Nahrungsaufnahme wie jede andere auch und verdient daher den selben respektablen Umgang wie andere Mahlzeiten größerer Menschen auch. Die Personen sollten sich in einer angemessenen Körperhaltung befinden können – gerade beim Stillen ist dies wichtig, um Haltungsproblemen und Verspannungen vorzubeugen -, sie sollten nicht durch Geruch, Lautstärke oder Temperatur beeinträchtigt werden. Das betrifft sowohl die Mutter als auch das Kind.
Um auch in der Öffentlichkeit stillen zu können, werden zum Schutz vor fremden Augen heute oft Stilltücher oder Stillschals angeboten. Wenn Frauen sich vor den Blicken anderer schützen möchten, finde ich die Verwendung von diesen Stoffbarrieren sinnvoll (allerdings nicht anders herum, wenn man auf Fürsorge andere Menschen vor dem Anblick schonen möchte, siehe oben). Gerade am Anfang einer Stillbeziehung, wenn es vielleicht auf Anhieb noch nicht so gut klappt mit dem Anlegen, können Frauen schnell verunsichert sein und wünschen sich keine ungewollten Zuschauer. Später dann, um den dritten Lebensmonat des Kindes, kann ein solches Tuch auch für das Kind sinnvoll sein, denn in dieser Zeit kommt es zu einem Entwicklungsschub, bei dem sich das Sehen stark verändert und Babys sind nun viel leichter ablenkbar als zuvor, was sich gerade beim Stillen darin zeigt, dass sie immer wieder die Brust loslassen, wieder ran gehen oder gar den Kopf wenden, während die Brust noch im Mund ist. Darüber hinaus sind Stilltücher aber nicht unbedingt vorteilhaft: Manche verhindern auch den Einblick der Mutter. Doch gerade auch darum geht es ja beim Stillen, denn wie Untersuchungen belegt haben, sehen Säuglinge gerade in dem Abstand gut und scharf, den sie einnehmen, wenn sie an der Brust der Mutter liegen und in ihr Gesicht blicken. Der Anblick der Mutter beim Stillen hat also eine Bedeutung für das Kind und sollte deswegen nicht aus irgendwelchen gesellschaftlichen Einflüssen unterbunden werden.
Leider ist es in Deutschland so, dass Besitzer von Cafés und Läden ein Hausrecht geltend machen können und das Stillen in ihren Räumlichkeiten untersagen dürfen – was immer wieder in den Medien zu lesen ist. In Schottland hingegen gibt es ein Gesetz zum Schutz des Stillens, nach welchem es strafbar ist, eine Mutter vom Stillen abzuhalten. Eine bei uns hierzu eingereichte Petition war bislang nicht erfolgreich.
Natürlich bedeutet dies nicht, dass stillende Mütter mit zwei entblößten Brüsten an einem Cafétisch sitzen müssen. Natürlich ist eine gewisse Diskretion möglich und auch angebracht, aber nicht in der Weise, in der sie oft eingefordert wird und besonders nicht, wenn sie die Rechte des Kindes auf Erfüllung seiner Grundbedürfnisse einschränkt.
Lieber Geschrei oder ein gestilltes Kind?
Das Stillen in der Öffentlichkeit hat zudem auch noch ganz handfeste Vorteile für alle Personen, die zugegen sind: Wenn Babys und Kleinkinder hungrig sind, machen sie auf sich aufmerksam. Können Sie es noch nicht mit Worten, tun sie es durch laute Äußerungen, durch Schreien und Weinen. Nahrung ist lebensnotwendig und Babys machen darauf sehr eindrücklich aufmerksam. Wer also schnell und beherzt das Stillen ermöglicht, verringert so auch die Zeit, in der das Kind auf sein Bedürfnis aufmerksam machen muss. Das ist vorteilhaft für das Kind, aber auch für alle anderen Anwesenden.
Woher sollen wir es lernen, wenn wir es nicht sehen?
Muttermilch ist die gesündeste Nahrung für das Kind und für lange Zeit die artgerechte Nahrung. Die verschiedenen Inhaltsstoffe der Muttermilch sind auf unterschiedlichen Ebenen wichtig für die kindliche Entwicklung. Dass Stillen also die beste Form ist, ein Kind zu ernähren, ist gewiss. Dennoch ist es so, dass das Stillen für viele Frauen nicht einfach ist. Stillhindernisse beginnen oft schon kurz nach der Geburt, besonders häufig bei Klinikgeburten. Oft müssen Kinder nicht abgestillt werden, weil die Mütter nicht stillen wollen, sondern weil sie nicht genügend oder richtige Unterstützung erhalten. Denn: Stillen ist nicht etwas, was wir instinktiv richtig machen. Stillen hat viel mit Vorbildern und Lernen zu tun. Wenn uns aber Vorbilder fehlen, fällt es uns schwer, dieses Verhalten auszuführen. Gerade deswegen ist das Stillen in der Öffentlichkeit auch für nachfolgende Generationen so wichtig: Kinder sollen auch in Zukunft mit der für sie richtigen und natürlichen Nahrung versorgt werden, Mütter sollen es einfach haben, stillen zu können. Dafür müssen Kinder sehen können, dass Babys gestillt werden. Sie müssen zusehen können, wie Kinder an die Brust gehalten werden. Beschränken wir diese Art der Nahrungsaufnahme immer mehr, nehmen wir auch zukünftigen Generationen die Chance, stillen zu können und es als natürlichen Vorgang zu betrachten.
Auf einmal zu groß fürs Stillen?
Besondere Irritation ruft in der Öffentlichkeit das Stillen von „größeren“ Kindern hervor. Dabei sind „größere“ Kinder nicht etwa Vorschulkinder, sondern bereits Kinder im Alter von 1 oder 2 Jahren werden beim Stillen kritisch betrachtet – und ihre Mütter ebenso. Es scheint fast, also würde auf einmal ab einer bestimmten Körpergröße das Stillen doch noch etwas Anrüchiges oder Verbotenes werden. Warum eigentlich? Auch nach dem ersten Geburtstag hat Muttermilch für die kindliche Entwicklung und besonders das Immunsystem besondere Inhaltsstoffe zu bieten. Das für Menschen sinnvolle Abstillalter liegt weit über dem, was wir hier als Durchschnitt betrachten. Stillen ist, wie oben aufgeführt wurde, keine sexuelle Handlung und wird es auch dann nicht, wenn das Kind aus Kleidergröße 80 hinaus gewachsen ist. Es obliegt jeder Mutter und jeder Familie selbst, zu entscheiden, wie lange ihre Stillbeziehung andauert und ob überhaupt gestillt werden soll oder nicht. Doch die gesunden Aspekte der Muttermilch sind nun einmal nicht von der Hand zu weisen. Dies gilt sowohl für Babys als auch ältere Kinder. Und daher sollte auch das Stillen älterer Kinder in der Öffentlichkeit nicht verpönt oder verlacht werden, sondern die selbe Berechtigung haben wie jede andere Nahrungsaufnahme auch. Denn – um es noch einmal zu wiederholen -: Stillen ist Nahrungsaufnahme – und manchmal auch noch Zuwendung, Kuscheleinheit, Beruhigung. Ganz einfach.

[inlinkz_linkup id=380800 mode=1]