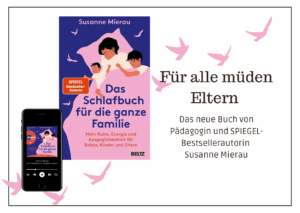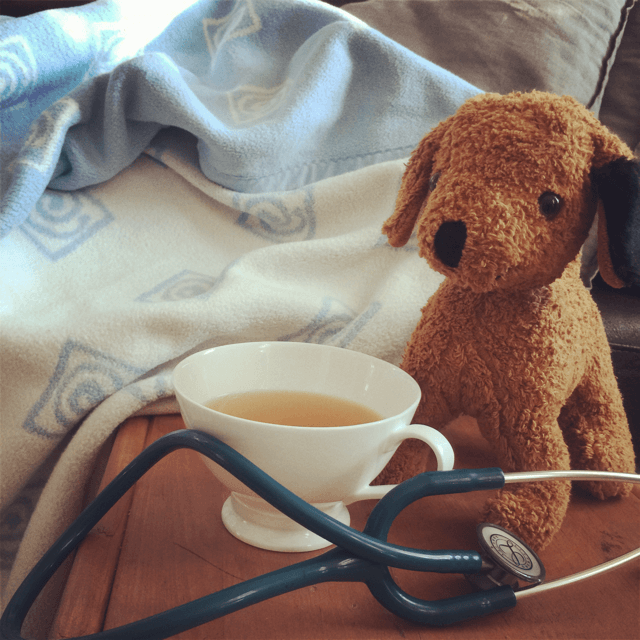Eigentlich ist alles bekannt: die Wohnung, die Geräusche, jedes einzelne Zimmer. „Komm mit, ich trau mich nicht…“ sagt das Kind. Eigentlich habe ich keine Lust, denn ich weiß: Alles ist in Ordnung. Es kann doch die Papierkugel allein zum Mülleimer bringen… Aber seit einigen Tagen wohl doch nicht. Angst steht im Raum, die meiner Meinung nach nicht da sein müsste. Aber meine erwachsenen Gedanken sind keine Kindergedanken. Kindergedanken sind anders. – Kinderängste sind anders. Und wenn sie da sind, sind sie da und lassen sich nicht wegschieben.
Woher kommt eigentlich der Gedanke, Angst müsse immer zur Seite geschoben werden? Warum ist sie so wenig erlaubt? So wenig gewürdigt? Denn eigentlich ist die Angst ein so wichtiges und hilfreiches Gefühl: Ein Gefühl, das uns schützt, uns zum Überlegen bringt. Angst sagt uns: Tu das lieber nicht! Fass das lieber nicht an, das könnte schief gehen! Geh da lieber nicht hinein, vielleicht ist das gefährlich. An so vielen Punkten wünschen wir uns als Eltern immer, dass unsere Kinder dieses oder jenes nicht getan hätten, nicht herunter gesprungen wären, etwas nicht in den Mund gesteckt hätten. An vielen Punkten wäre die Angst hilfreich – und doch versuchen wir immer wieder, sie den Kindern abzutrainieren durch Worte wie „Stell Dich nicht so an!“ „Trau Dich!“ „Sei kein Angsthase!“
Warum Kinder sich ängstigen
Die Angst ist bei unseren Kindern da, um sie zu beschützen. Manchmal auch gerade dann, wenn das magische Denken Einzug gehalten hat zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr: alles ist möglich und könnte sein. Hexen, Drachen unter dem Bett, der Staubsauger könnte wirklich die Füße aufsaugen oder die Toilettenspülung das Kind hinunterspülen. Es ist nicht „nur“ Fantasie, es ist eine Art gelebte Fantasie, die für das Kind real sein könnte. Traumgestalten, unsichtbare Freunde – sie haben ihren Raum in dieser Zeit und manchmal darüber hinaus. Die Auseinandersetzung mit der Welt und dem, was wirklich ist und sein kann, und dem, was nicht möglich ist. Der Beginn der Zeit, sich in andere Menschen hinein zu versetzen und zu verstehen, was sie denken und fühlen und warum.
Angst auslösen können auch viele andere Dinge: Diffuse, unbewusste Angst davor, nicht genügend Ressourcen zu haben, wenn ein Geschwisterkind geboren wird und nun Zuwendung und vieles andere geteilt werden muss. Angst vor noch nicht verstehbaren Zeitbegriffen: Später, bald, übermorgen sind noch nicht so richtig fassbar. Angst kann ausgelöst werden, wenn wir Erwachsene uns nicht an diese so schwer verstehbaren Begriffe halten und das Kind nicht exakt nach dem Mittagessen, sondern etwas später abholen und die Angst entsteht, vergessen worden zu sein.
Für Kleinkinder und Vorschulkinder, ja selbst Schulkinder gibt es viele Gründe für Ängste, denn auch wenn sie nun schon einige Jahre auf dieser Welt leben, leben sie gleichzeitig auch erst ein paar Jahre hier und haben noch viele der Regeln und Besonderheiten dieses Lebens nicht verstanden. Noch immer können Kinder staunen über diese Welt und sehen und erleben Dinge, die sie nie zuvor gesehen oder erlebt haben. Die Welt ist noch immer neu und unbekannt.
Wie Eltern auf Ängste reagieren sollten
Was also hilft, wenn das Kind Angst hat? Das Annehmen dieses Zustandes. Wir können die Ängste eines Kindes nicht mit Worten abtun. Ein „Hab keine Angst!“ hilft unserem Kind nicht bei seinem Problem und wird die Angst nicht mindern. Wenn Kinder keine Zuwendung in Bezug auf ihre Ängste bekommen, tragen sie sie vielleicht irgendwann nicht mehr vor. Doch das bedeutet nicht, dass sie nicht mehr vorhanden sind. Wichtig ist es, dem Kind den richtigen Umgang mit der Angst zu vermitteln und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Warum hat mein Kind Angst? Was können wir unternehmen, um die Angstursache zu beseitigen? Manchmal gibt es konkrete Handlungen, die hilfreich sein können, manchmal muss auch ein Gefühl der Sicherheit und Stabilität wieder hergestellt werden, beispielsweise wenn das Kind beängstigende Situationen erlebt hat oder sich in einer Umbruchphase befindet. Auf jeden Fall sollten kindliche Ängste jedoch immer ernst genommen werden. Wir können zusammen nach Ursachen suchen und Lösungen, so dass die Angst nachhaltiger überwunden werden kann als durch ein „Stell Dich nicht so an!“. Es ist gut, wenn Kinder Mut entwicklen und eigene Lösungsstrategien, doch dafür ist eine sichere Basis gut, besonders bei sehr empfindsamen und vorsichtigen Kindern. Fühlen sie sich sicher, können sie über sich und ihre Ängste hinaus wachsen.
- Angst des Kindes ernst nehmen
- Akzeptieren, dass das Kind Angst hat
- Angst nicht bewerten (kindliche Ängste sind nicht albern)
- Über die Angst sprechen: Warum hat das Kind Angst und wann immer?
- Vorbild sein und eigene Ängste und Lösungen eingestehen
- Lösungsmöglichkeiten suchen: Gibt es konkrete Aktivitäten oder braucht das Kind ein sicheres Gefühl? Nach Möglichkeit (je nach Alter) Lösungen vom Kind vorschlagen lassen.
- Angst über die Zeit hinweg begleiten: Ich bin bei Dir, ich helfe Dir.
Welche Ängste Kinder auch immer haben und egal wie „unwichtig“ oder „unsinnig“ sie in unseren Augen sein mögen: Es lohnt sich immer ein genauer Blick darauf und eine Suche nach den Ursachen.
Eure