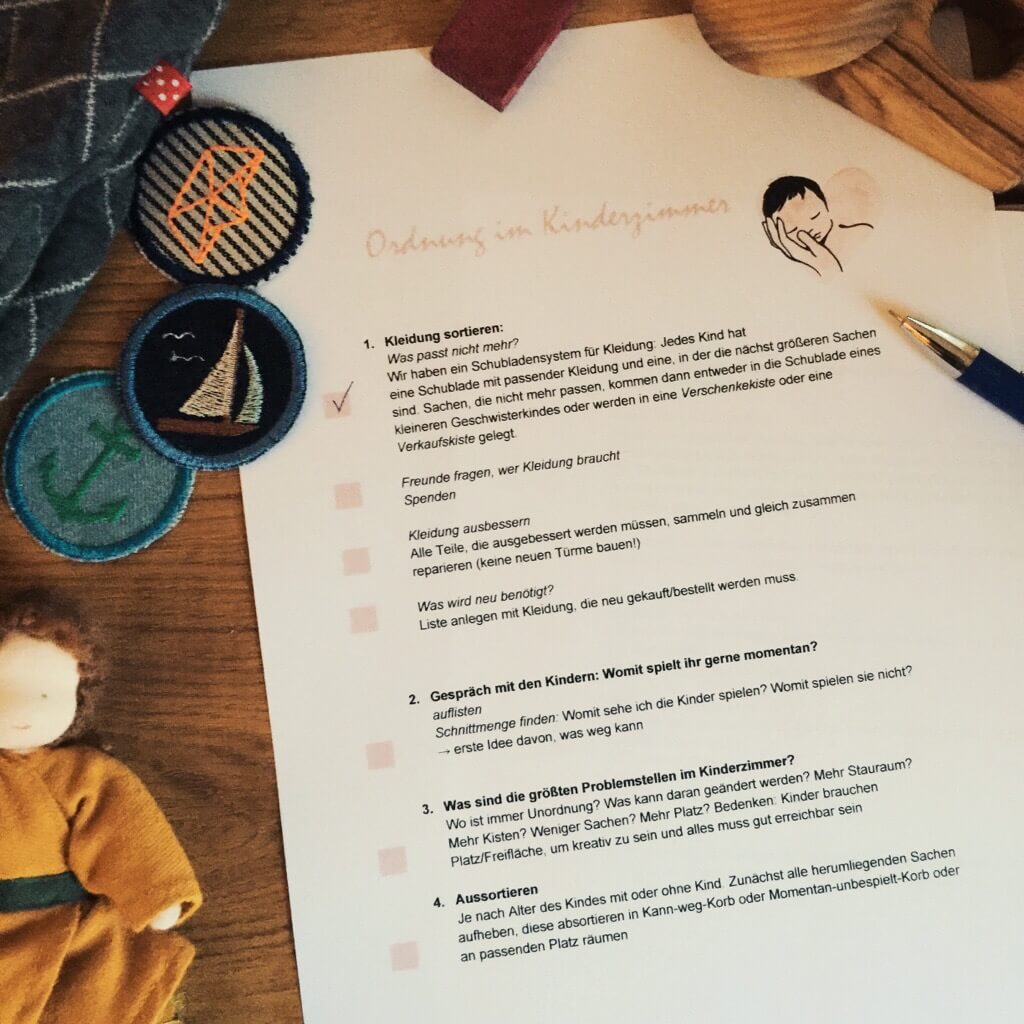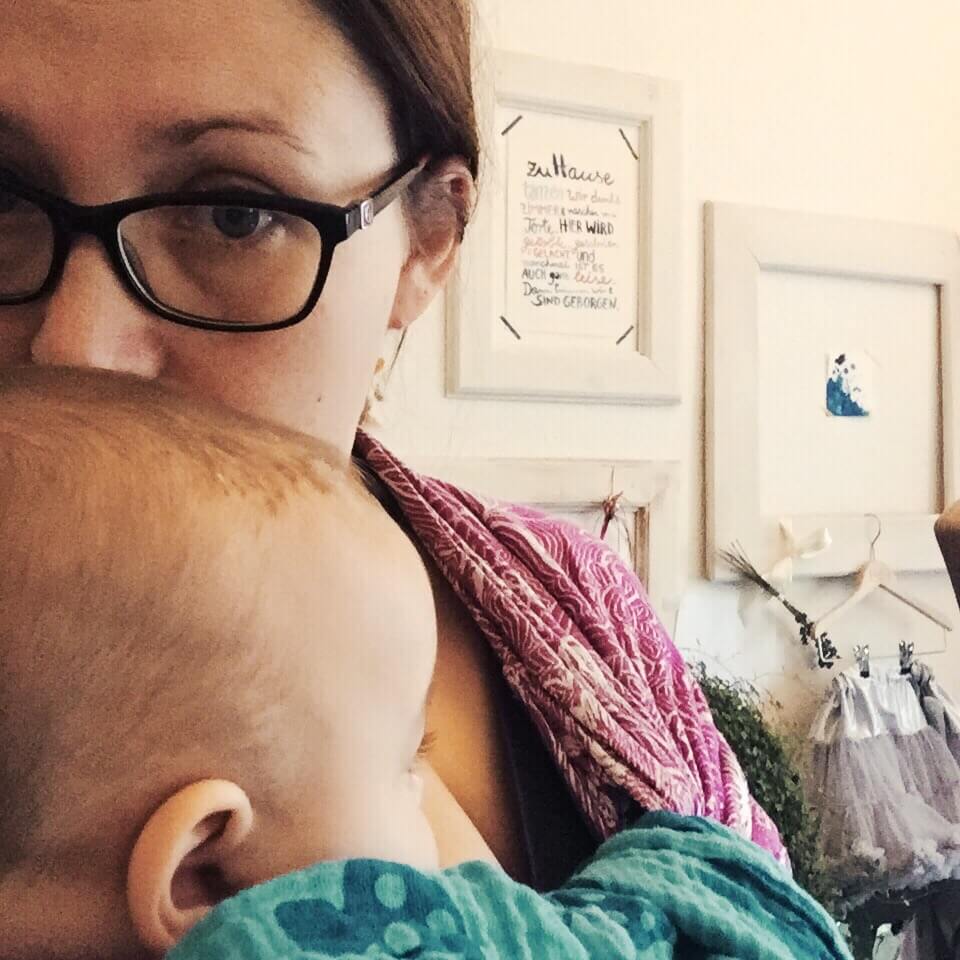Kürzlich schrieb mein Mann hier in einem seiner Artikel darüber, dass das Kind in Bezug auf die Lehrer*innen in der Schule recht unterschiedliche Empfindungen hat und einige Lehrer*innen schlichtweg nicht mag. Daraufhin ergab sich auf Facebook eine Diskussion darum, ob Kinder ihre Lehrer*innen mögen müssen oder nicht und ob es im Falle von negativen Gefühlen die Aufgabe der Eltern sei, die Kinder dahingehend zu beeinflussen, dass sie die Lehrer*innen doch mögen. Ich habe lange darüber nachgedacht, mit anderen Eltern diskutiert und möchte dazu gerne unsere persönliche Einstellung erläutern.
Die Qualität in Kindergärten steht in Frage
Vor kurzer Zeit hat sich die Diskussion um die Betreuungsqualität in den Kindertageseinrichtungen eröffnet. Schon lange gibt es verschiedene Missstände. Nun ist im Rahmen der Debatte um den Ausbau der Betreuungsplätze unter Vernachlässigung der pädagogischen Qualität endlich die Tür dazu aufgegangen, öffentlich über die Probleme in der Kinderbetreuung zu sprechen. Die ZEIT hat sich diesem Thema in einer ganzen Artikelreihe gewidmet, wie hier und hier zu lesen ist und berichtet hier darüber, wie Kontrollsysteme versagen. Auch auf den Elternblogs (als Spiegel der Gesellschaft) ist immer wieder von den schlimmen Zuständen in einigen Kitas zu lesen, wodurch sich die schreibenden Eltern für den Weg „Kindergartenfrei“ entscheiden. Es ist deutlich: Es gibt – nicht überall und in jeder Kita, aber an vielen Stellen – keine gute Qualität für die Begleitung von Kindern. Es ist zu hoffen, dass die nun angefangene Diskussion um die Qualität zu Änderungen führt.
Müssen wir bei „großen Kindern“ nicht diskutieren?
Doch bislang beschränkt sich die Diskussion größtenteils auf Tagespflege und Kindergarten. Schule und Hort tauchen nur vereinzelt in der Diskussion um Qualität auf und oft werden die Besorgnisse der Eltern von größeren Kindern auch kritisch betrachtet oder verlacht. Die Kinder seien ja nun „groß“ und Eltern wären Helikoptereltern. Und auch wenn es durchaus Aspekte gibt, die an den Eltern zu bemängeln sind, die ihren Kindern zu wenig Freiraum lassen für die Entwicklung und zu wenig Selbständigkeit ermöglichen, gibt es durchaus Aspekte der Qualität des Lehrer*innenverhaltens, die kritisiert werden dürfen und sollten. Kürzlich war beispielsweise hier bei Butterflyfish über die Loser-Bank im Sportunterricht zu lesen. Ein Einzelfall? Wahrscheinlich nicht. Aus persönlichen Gesprächen höre ich immer wieder davon, wie Kinder in den ersten Klassen von Lehrer*innen und/oder Erzieher*innen vorgeführt werden: Kinder, die vor der ganzen Klasse getadelt werden für Verhalten, sich sogar noch in die Ecke stellen mussten. Kinder, denen versagt wurde, auf die Toilette zu gehen in der ersten Klasse und die deswegen in die Hose machen mussten. Kinder, deren Familienstand oder sozioökonomischer Status vor der Klasse diskutiert wird. Es scheint, als sei nicht nur die Qualität der Kindertagesbetreuung zu diskutieren, sondern auch das pädagogische Verhalten der Lehrkräfte und/oder Erzieher*innen in der Schule. Und diese Diskussion muss sich auf alle Schulen erstrecken. Oft ist zu hören, dass die Qualität in freien oder privaten Schulen besser sei. Doch nicht alle Familien können sich das leisten.
Mit Schulkindern reden
Was bedeutet das nun für das Empfinden des Kindes und die Frage danach, ob ein Kind alle Lehrer*innen mögen muss? Nein, natürlich muss es das nicht. Können wir ernsthaft erwarten, dass ein Kind, das oben geschilderte Situationen erleben muss, die Personen mag, die ihm das antun? Kein Kind muss alle Menschen mögen. Genauso wenig wie Kleinkinder alle anderen Menschen mögen oder artig die Hand oder ein Küsschen geben müssen. Wir müssen die Empfindungen unserer Kinder ernst nehmen und ein offenes Ohr dafür haben, was sie aus ihrem Schulalltag berichten. Es ist vollkommen legitim, ihnen zu vermitteln: Nein, Du musst Deine Lehrer*innen nicht mögen. In schwerwiegenden Fällen wie den oberen müssen wir als Eltern mit den Lehrkräften ins Gespräch kommen und unsere Kinder in Schutz nehmen: zu ihrem eigenen Schutz und auch in Hinblick darauf, was Kinder aus diesem Verhalten lernen und wie sie zukünftig mit anderen Menschen umgehen. Sie verbringen viel Zeit in der Schule und erlernen neben den fachlichen Inhalten auch soziale Aspekte. In Hinblick auf die Gestaltung unserer Zukunft liegt es an uns und anderen Vorbildern, was wir unseren Kindern mitgeben und wie sie später das Leben gestalten. Und wir müssen als Eltern ihren negativen Gefühlen Raum geben und sie zulassen. Wut, Enttäuschung, Trauer sind Gefühle einen Kindes, die es erlebt und die es auch ausdrücken muss. Wir als Eltern sollten sie wahrnehmen und auffangen. Wir können mit Lehrkräften sprechen. Aber vor allem auch mit unseren Kindern und ihnen sagen: „Nein, Du musst Menschen nicht mögen, die sich Dir gegenüber schlecht verhalten.“ Aber gleichzeitig können wir ihnen vermitteln, wie sie damit gut umgehen können und andere Menschen respektvoll behandeln, auch wenn sie sie nicht mögen. Und dass in den vielen Schuljahren ganz sicher auch Lehrer*innen dabei sind, die sie mögen werden. Bis dahin begleiten wir sie, stärken sie und unterstützen.
Was meintIhr dazu? Wie geht Ihr damit um? Habt Ihr auch Negativbeispiele erlebt?
Eure