Wir sitzen im Restaurant beim Essen, als mein kleiner Sohn auf einmal von seinem Stuhl quietschend aufspringt, sich umdreht und wild gestikuliert hinter dem Stuhl. Was denn los sei, frage ich. „Drache mich immer am Rücken kitzelt!“ Ruft er empört. – Natürlich sitzt dort kein Drache, natürlich hat ihn niemand von hinten am Rücken gekitzelt. Aber für ihn sind dieses Kitzeln und dieser Moment real: Dort saß gerade noch ein kleiner Drache und hat ihn gekitzelt. An einem anderen Tag erklärt mein anderer Sohn abends, er könne wirklich nicht durch den dunklen Flur gehen, denn seit kurzer Zeit würde dort ein Gnarfling wohnen. Das sei tagsüber nicht besonders schlimm, abends aber würde das gar nicht gehen. So sehr uns diese Angst als unsinnig erscheint, ist sie jedoch real: Sie ist da und eine bestehende Realität. Und dann gibt es auch noch die Geschichten des großen Kindes: Beispielsweise, dass es in dieser Woche wirklich kein neues Musikstück üben müsse aus der Musikschule, denn es sei noch das alte Musikstück, das gespielt wurde. Letztlich stellt sich heraus: Es gab doch ein neues Stück, das nun aber nicht gelernt wurde. Die Zeit wurde lieber für anderes verwendet.
Was ist eigentlich eine Lüge?
Wenn wir die „Lügengeschichten“ von Kindern im Laufe der Kindheit betrachten, sehen wir, wie sie sich ändern, wie sich ihre Inhalte und Absichten dahinter ändern und auch der Umgang der Kinder damit. Wenn etwas für uns als Lüge erscheint, weil wir wissen, dass es nicht wahr ist, muss es für das Kind dennoch keine absichtlich geplante Lüge sein, sondern kann seiner aktuellen Weltsicht entspringen.
Auch unsere erwachsene Ansicht davon, dass Lügen per se schlecht seien, ist in Bezug auf Kinder oft schwierig, denn selbst dann, wenn das Kind eine Unwahrheit berichtet, bedeutet es nicht, dass es uns damit verärgern wollte oder absichtlich böse wäre. Selbst hinter einer geplanten Lüge liegt eine Absicht, ein Bedürfnis oder ein Wunsch, der erkannt werden will – oder zumindest ein Entwicklungsbedürfnis. Lügen ist keine Sünde, sondern ein Baustein einer normalen Entwicklung.
Lügen im Laufe der Zeit
Das obige Beispiel illustriert bereits: Lügen verändert sich im Laufe der Zeit und eine Unwahrheit, die ein Kind berichtet, muss nicht zwangsweise eine Lüge sein. Imaginäre Freunde sind ebenso für die Kinder real wie die Angst vor Hexen, Monstern oder anderen Wesen, die in der magischen Phase vorkommt. Wenn das Kind von diesen Dingen berichtet, lügt es uns nicht an. Und es ist auch nicht schlimm, dass es an diese magischen Wesen glaubt oder sie es sogar eine Zeit lang begleiten. Oft verbirgt sich dahinter auch eine wichtige Information, beispielsweise die normale Angst in diesem Alter vor der Dunkelheit oder dem Schlafen allein. Auch die Fantasie ist eine Kraft und Entwicklung, mit der das Kind umzugehen lernt im Laufe der Zeit und es ist gut, wenn es die Möglichkeit hat. Wenn unser Kind also von den fantastischen Fantasiewesen berichtet, sollten wir diese Informationen annehmen und respektieren und vielleicht sogar einmal probieren, in diese Welt einzutauchen.
Eine Lüge wird dann erzählt, wenn ein Kind ganz bewusst eine Unwahrheit erzählt und weiß und fühlt, dass das Gesagte nicht richtig ist. Dies entsteht aber erst ab dem 3. Geburtstag nach und nach, wenn das Kind langsam fähig ist, sich in andere Menschen hinein zu versetzen. Und gerade in diesem Zusammenhang können wir das Lügen auch als ein Spiel mit der Perspektivübernahme betrachten: Viele Kinder machen sich auch einen Spaß daraus und experimentieren damit, ob sie eine andere Person täuschen können. Wie so viele andere Entwicklungsmeilensteine ist auch das Lügen etwas, das das Kind spielerisch im Laufe der Zeit lernt. Erst im Vorschulalter wird dann bewusst eine andere Geschichte erzählt, als die erlebte.
Lügen bei (Geschwister)streitigkeiten
Besonders wichtig ist ein sensibler Umgang mit „Unwahrheit“ auch im Kontext von (Geschwister)streitigkeiten. Nicht selten berichtet ein kleineres Geschwisterkind davon, dass das größere Kind es geärgert hätte. Dass diesem Ärger aber vielleicht ein eigenes Ärgern vorausging, auf das das größere Geschwisterkind reagiert hat, wird dabei verschwiegen, weil es vom kleinen Kind schon ausgeblendet wurde. Eltern neigen dann manchmal dazu, die Schuld dem größeren Kind zu geben und es des Lügens zu beschuldigen. Bei Geschwisterstreitigkeiten, zu denen man hinzugezogen wird, ist es deswegen besonders wichtig, neutral zu bleiben und zu erklären, dass man nicht dabei war und eher eine Vermittlungsposition zu übernehmen (wenn nötig) als zu beurteilen.
Muss ein Kind lügen (lernen)?
Wenn Kinder erstmal lügen bzw. Eltern eine Geschichte als wirkliche Lüge wahrnehmen, ist das manchmal ein Schreck: „Ich habe mein Kind doch zur Ehrlichkeit erzogen!“ oder „Es muss doch nicht lügen, ich bin doch nicht streng.“ Können Gedanken sein, die sich in den Vordergrund schieben. Wichtig ist hier jedoch, wieder die Perspektive des Kindes zu übernehmen: Das Lügen ist ein Entwicklungsmeilenstein, der seine Berechtigung hat. Auch in unserer Gesellschaft gibt es Lügen, die akzeptiert oder sogar gewünscht sind, wenn wir beispielsweise besonders schonend mit den Gefühlen anderer umgehen wollen „Nein, das ist nicht schlimm!“ Oder „Danke, darüber freue ich mich!“ Kulturübergreifend lügen Kinder und auch im Tierreich ist das Schwindeln zu finden. Es ist ein wesentlicher Meilenstein der Entwicklung für das Leben in der Gemeinschaft und das Verständnis der Aussagen anderer Menschen: Denn wenn ein Kind selbst bewusst lügen kann, weiß es auch, dass andere das tun und überdenkt Aussagen und Verhalten anderer.
Was steht hinter der Lüge?
Eine Lüge muss nicht problematisch sein, aber wir problematisieren sie oft. Und hier verdeutlicht sich, warum die Begleitung des Kindes dabei so wichtig ist: Wenn wir eine Unwahrheit annehmen ohne Bewertung und die Ursache versuchen zu verstehen, kann es sein, dass das Kind zukünftig weniger darauf angewiesen ist, zu flunkern. Neben dem Entwicklungsspiel „Lügen“ gibt es auch Lügen, hinter denen sich eine Aussage verbirgt, gerade bei den größeren Kindern. Hinter der Lüge, das Kind habe keine Hausaufgaben auf oder kein neues Musikstück zu lernen, kann der Wunsch stehen, mehr Zeit für andere Beschäftigungen zu haben. Diese Ursache herauszufinden ist wichtig, denn wenn wir das Grundproblem beheben oder zumindest dem Kind signalisieren „Ich habe Deinen Wunsch verstanden.“ hat es weniger Grund, uns nicht die Wahrheit zu sagen. Auch wenn sich das Kind heimlich Süßigkeiten einsteckt im Laden oder bei Freunden können wir uns fragen: Was steht dahinter? Sollten wir vielleicht zu Hause unseren Umgang damit überdenken, sind wir zu streng oder einengend, dass das Kind den Wunsch nicht ausspricht, sondern heimlich selbst erfüllt?
Lügt ein Kind aus Angst oder Sorge?
Wenn das Kind in Situationen, in denen ihm oder ihr ein Missgeschick passiert, lügt, können wir überlegen, warum es das tut und seine Schuld zurückweist oder einer anderen (imaginären) Person zuweist: Vielleicht hat es Angst vor einer Bestrafung, vor Ärger. Vielleicht haben wir in einer ähnlichen Situation einmal sehr streng reagiert und es versucht nun, dieser Reaktion mit einer Lüge aus dem Weg zu gehen. Vielleicht schämt es sich mittlerweile auch für das Verhalten, das es gezeigt hat und versucht mit der Lüge gewissermaßen, dieses ungeschehen zu machen.
 Bestrafungen sind sowohl negativ, da sie das Lernen effektiv behindern, aber die stören auch das Vertrauen des Kindes. Es ist besser, wenn das Kind offen sagen kann: „Mir ist die Tasse kaputt gegangen.“ als dass es dies verleugnen muss aus Angst vor Fernseh- oder Computerverbot oder Beschimpfungen. Wenn Kinder etwas kaputt machen, ungeschickt sind, etwas in unseren Augen „falsch“ machen, ist es deswegen gut, die Situation aus unserer Perspektive zu umschreiben und das Kind nicht zu beschämen, d.h. zu sagen „Ich bin traurig, weil die Tasse kaputt gegangen ist“ statt zu sagen „Du hast sie kaputt gemacht, dafür musst Du sie von Deinem Taschengeld bezahlen.“ Kinder sollten immer das Gefühl haben, uns alle Probleme anvertrauen zu können und über Probleme reden zu können. Und als Eltern können wir diese Ehrlichkeit auch offen wertschätzen und uns dafür bedanken, wenn ein Kind ehrlich ein Missgeschick zugegeben hat. Das öffnet den Raum für Vertrauen und gibt einen wichtigen Impuls dafür, wie auch später mit Missgeschicken oder Misserfolgen offen umgegangen werden kann.
Bestrafungen sind sowohl negativ, da sie das Lernen effektiv behindern, aber die stören auch das Vertrauen des Kindes. Es ist besser, wenn das Kind offen sagen kann: „Mir ist die Tasse kaputt gegangen.“ als dass es dies verleugnen muss aus Angst vor Fernseh- oder Computerverbot oder Beschimpfungen. Wenn Kinder etwas kaputt machen, ungeschickt sind, etwas in unseren Augen „falsch“ machen, ist es deswegen gut, die Situation aus unserer Perspektive zu umschreiben und das Kind nicht zu beschämen, d.h. zu sagen „Ich bin traurig, weil die Tasse kaputt gegangen ist“ statt zu sagen „Du hast sie kaputt gemacht, dafür musst Du sie von Deinem Taschengeld bezahlen.“ Kinder sollten immer das Gefühl haben, uns alle Probleme anvertrauen zu können und über Probleme reden zu können. Und als Eltern können wir diese Ehrlichkeit auch offen wertschätzen und uns dafür bedanken, wenn ein Kind ehrlich ein Missgeschick zugegeben hat. Das öffnet den Raum für Vertrauen und gibt einen wichtigen Impuls dafür, wie auch später mit Missgeschicken oder Misserfolgen offen umgegangen werden kann.
Der Umgang mit Lügen in der Familie
Dass Menschen lügen, ist normal. Dass Kinder lügen, ist ebenso normal. Wie in vielen anderen Bereichen sind sie auch hier auf dem Weg, etwas Wichtiges zu lernen für das Leben in unserer Gesellschaft und der Weg dorthin ist eben so, wie es die Entwicklungswege immer sind: auch etwas holprig und steinig und auf eine gute Begleitung angewiesen. Es ist gut, wenn wir unsere Kinder auch durch die Lügen-Entwicklungsphase gut begleiten und eine Unwahrheit annehmen und versuchen, die Beweggründe dahinter zu verstehen. Ist es eine bewusste Lüge, können wir unser Empfinden dazu verbalisieren oder auch versuchen, für das Kind zu übersetzen, was durch die Lüge bei uns ankommt. Wichtig ist, Kinder zu begleiten und nicht zu bestrafen. Wir können nicht mehr Ehrlichkeit durch Strafandrohung einfordern – zumindest wird ein solches Verhalten nicht das gewünschte Ergebnis erzielen. Vor allem aber sollten wir auch kurz über uns selber nachdenken und die Situationen, in denen unser Kind uns vielleicht bei einer kleinen Lüge aus Höflichkeit ertappt wie „Ja, das hat mir gut geschmeckt!“ Oder „Ich habe jetzt gerade leider keine Zeit zu telefonieren, weil…“ und wenn wir uns unser eigenes Alltagsverhalten bewusst machen, haben wir vielleicht auch wieder mehr Humor und Verständnis für die Lügenversuche unseres Kindes.
Eure








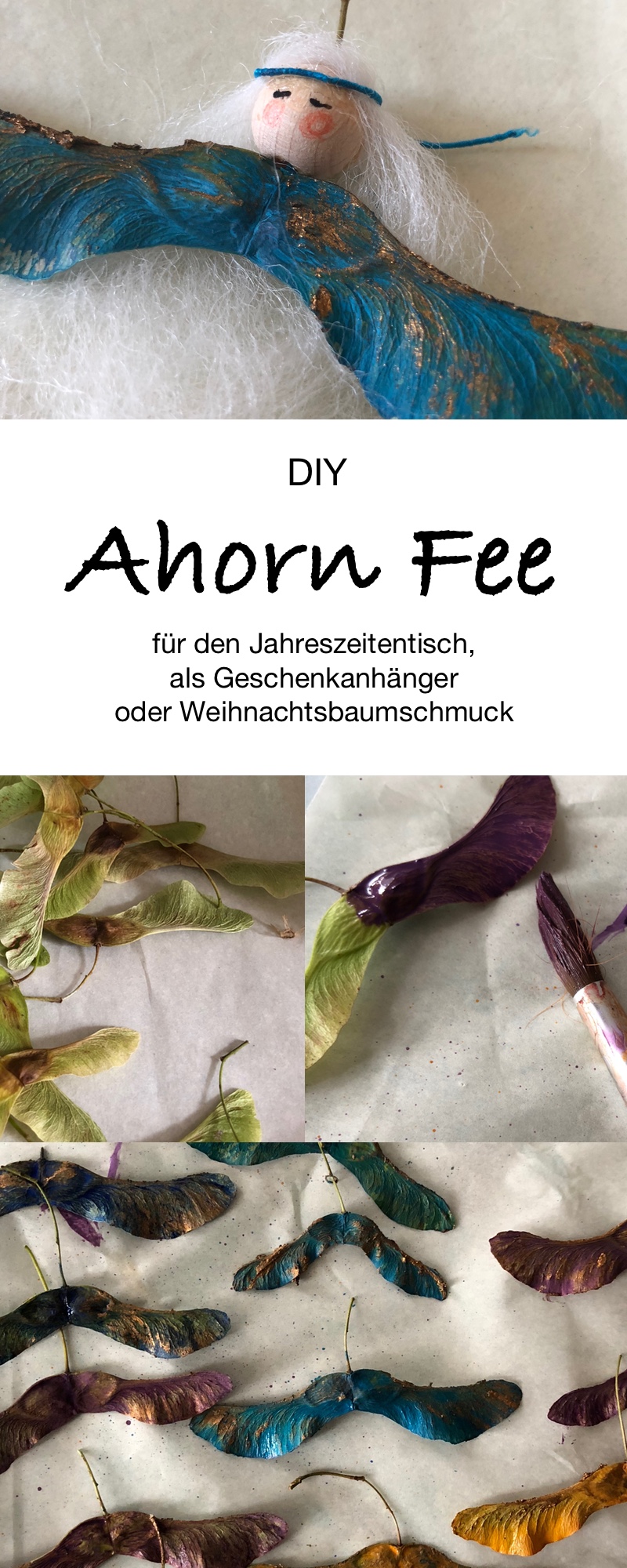


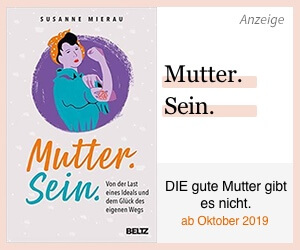






 Winter konserviert wird, damit eben nicht die frischen Erdbeeren im Winter gekauft werden müssen, sondern auf das selbstgemachte Sommeressen zurück gegriffen werden kann: Von Konfitüren und Marmelade über fermentiertes Essen bis hin zu Pesto, eingemachten Gurken oder getrocknetem Obst: Es gibt viele Möglichkeiten, die auch zu Hause gut machbar sind. Wer mag, kann beispielsweise mit getrockneten Apfelscheiben beginnen, die auf einer Schnur aufgefädelt in einem trockenen Raum getrocknet werden und später geknabbert werden können. Auch hierzu gibt es viele Anregungen auf Blogs, Videos oder Bücher wie Caswell/Siskin „
Winter konserviert wird, damit eben nicht die frischen Erdbeeren im Winter gekauft werden müssen, sondern auf das selbstgemachte Sommeressen zurück gegriffen werden kann: Von Konfitüren und Marmelade über fermentiertes Essen bis hin zu Pesto, eingemachten Gurken oder getrocknetem Obst: Es gibt viele Möglichkeiten, die auch zu Hause gut machbar sind. Wer mag, kann beispielsweise mit getrockneten Apfelscheiben beginnen, die auf einer Schnur aufgefädelt in einem trockenen Raum getrocknet werden und später geknabbert werden können. Auch hierzu gibt es viele Anregungen auf Blogs, Videos oder Bücher wie Caswell/Siskin „