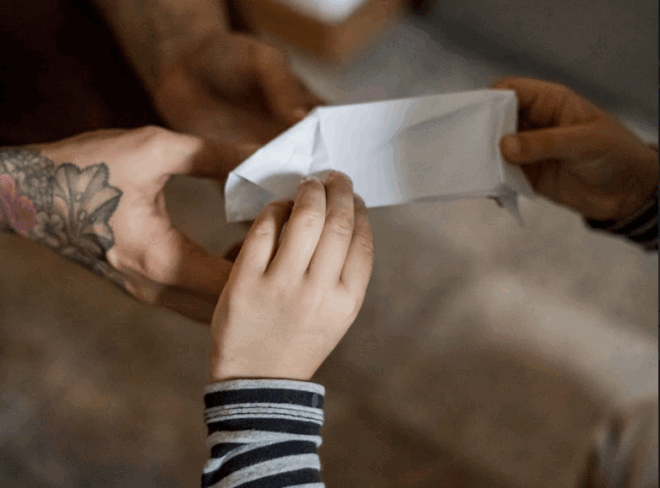Wenn wir an ein „kontrollierendes Erziehungsverhalten“ denken, denken wohl die meisten Menschen erst einmal an Druck, Strenge, das Unterdrücken von Bedürfnissen. Kontrolle hat in dieser Vorstellung etwas Lautes, Hartes – und Offensichtliches. Doch Kontrolle kann auch ganz anders aussehen: Sie kann liebevoll verpackt sein in weichen Worten, mit einem Lächeln garniert und dennoch dem Kind keinen anderen Weg ermöglichen als jenen, den man sich selbst vorgestellt hat.
Freundliches Drängen ohne Option
Kontrolle zeigt sich nicht nur in dem „Mach das sofort!“, sondern auch in dem „Na, möchtest du nicht lieber…?“, das eigentlich keine echte Wahl lässt. Sie steckt im sanften Schieben, im ständigen Erinnern, das sich nach außen wie Unterstützung anhört, innen aber den gleichen Kern hat: Das Kind soll nicht selbst entscheiden, sondern in eine Richtung gelenkt werden. „Ich habe als Bezugsperson einen Plan von der Welt und von dir und diesem Plan soll gefolgt werden!“
Ein Kind, das immer wieder von außen bestimmt wird, lernt allerdings nicht, eigene Entscheidungen zu treffen und Erfahrungen zu sammeln, sondern passt sich an Erwartungen an. Auch wenn diese Erwartungen freundlich vorgetragen sind, bleiben sie doch Erwartungen, die einengen. Sie geben das Gefühl, nur dann gut zu sein, nur dann geleibt zu werden, wenn man sich anpasst. Kinder brauchen den Raum, Fehler zu machen, Umwege zu gehen, Dinge anders zu tun, als wir uns das vorstellen. Und vor allem brauchen sie das Gefühl, dass sie liebenswert sind als der Mensch, der sie sind. Dass sie einfach als Mensch Respekt verdient haben, dass jemand sie sieht und annimmt, wie sie sind. Wer ihnen stattdessen ununterbrochen mit vermeintlich hilfreichen Vorschlägen den Weg weist, hält sie genauso klein wie der, der mit Druck und Strenge führt.
Achtung: Orientierung erlaubt!
Natürlich steht nicht hinter jeder Beeinflussung gleich ein kontrollierender Erziehungsstil und nicht jedes Nein ist eine Einengung. Es ist wichtig, Kindern die sozialen, dinglichen und körperlichen Grenzen aufzuzeigen und ihnen Orientierung zu bieten in dieser neuen Welt. Die Frage lautet vielmehr: Zieht sich ein Muster durch mein Verhalten, das dem Kind keinen Raum gibt oder biete ich lediglich Halt in der Welt? Schränkt meine Sicht und mein Wollen die Selbständigkeit meines Kindes ein, so dass es nicht sein kann, wer es eigentlich ist und erlebt das eigene Selbst als unliebsam? Oder vermittle ich Wertschätzung und unterstütze mein Kind darin, dass es seine Schwächen überwindet, damit diese keine Hindernisse werden in der Entwicklung?
Was will ich wirklich?
Die Herausforderung liegt darin, das Bedürfnis nach Kontrolle in uns selbst zu erkennen. Es entsteht oft aus Sorge, aus Liebe, aus dem Wunsch, das Beste zu ermöglichen. Und doch ist gerade dieses „Beste“ nicht immer das, was das Kind jetzt braucht. Kinder brauchen auch Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Sie brauchen Eltern, die aushalten können, dass manches nicht nach Plan läuft, dass Dinge länger dauern, dass Umwege gegangen werden – und dass Menschen eben nicht perfekt sind oder so, wie man sie selbst haben will.
Den Erziehungsstil auf Kontrolle aufzubauen, ist letztlich nicht nur für das Kind ungünstig, sondern auch anstrengend für die Erwachsenen: Auf der Seite der Erwachsenen bedeutet es, dass die erwachsene Person das Kind auf eine bestimmte Art/in einer bestimmten Art braucht, um sich gut zu fühlen damit. Kontrollierende Erwachsene versuchen auf verschiedene Arten, das Kind dazu zu bringen, so zu sein, wie sie es haben wollen.
Selbstwirksamkeit lässt Selbstwert wachsen. Selbstwirksamkeit stützen bedeutet nicht, dass wir unsere Kinder allein lassen, sondern dass wir uns bewusst zurücknehmen, wo sie selbst wachsen können. So spürt das Kind Vertrauen in sich.
Eure
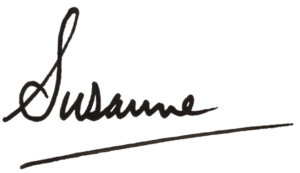
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich der Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für Eltern, die Kinder bindungssicher begleiten und die eigenen Bedürfnisse dabei nicht aus dem Blick verlieren wollen. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen. Sie arbeitet in eigener Praxis in Eberswalde.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de