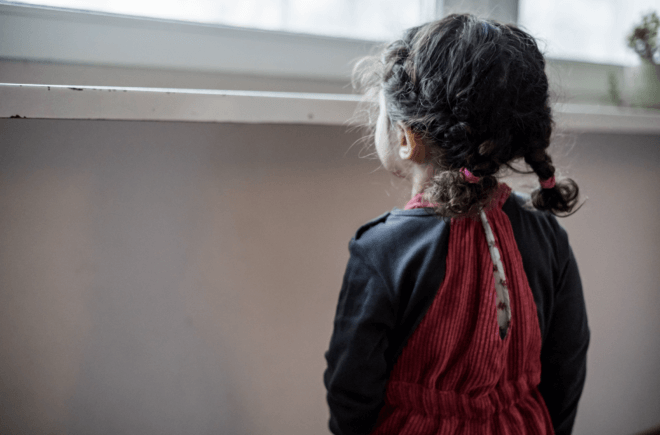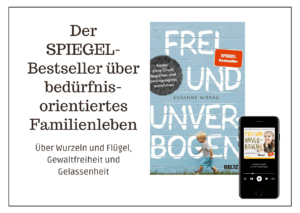Im Familienleben müssen Erwachsene viele Entscheidungen treffen. Selbst dann, wenn wir versuchen, demokratisch Familie zu leben und unsere Kinder an einigen Entscheidungen altersgerecht beteiligen, gibt es dennoch viele Entscheidungen, die Eltern allein treffen müssen, die aber alle im Familiensystem betreffen werden: Ziehen wir um, weil ich einen neuen Job habe, bei dem ich mehr verdienen werde oder weil die Miete zu hoch ist und wir das Geld besser für andere Dinge ausgeben. Stocke ich meine Stunden auf bei der Arbeit, nutze ich mehr außerfamiliäre Betreuung. Trenne ich mich, weil ich nicht glücklich bin, auch wenn das Kind in dieser Konstellation aktuell (noch) glücklich ist. – Es gibt eine Vielzahl von Entscheidungen, die wir treffen müssen, weil sie sinnvoll sind aus unserer erwachsenen Perspektive und/oder langfristig der Nutzen dieser Entscheidungen überwiegen wird.
Deine rationale Entscheidung ist nicht zwangsweise für dein Kind logisch
Als Erwachsene können wir langfristig planen und überblicken in der Regel komplexe Zusammenhänge, die für unsere Kinder in ihrer Tragweite oder Bedeutsamkeit noch nicht überschaubar sind. Sie können nicht nachfühlen, wie es sich anfühlen mag, in einer Beziehung zu bleiben, obwohl man den anderen nicht mehr liebt und was das mit den beiden Erwachsenen langfristig bedeutet, ebenso wie für die Kinder in diesem Familiensystem. Sie können finanzielle Auswirkungen einer zu teuren Wohnung oder den Vorteil eines Umzugs aufgrund eines Jobwechselns nicht abschätzen und wären zweifelsfrei überfordert damit, würden wir von ihnen eine verlässliche Auskunft hierzu erwarten, wenn es sich um ein drängendes Thema handelt. Weder können wir erwarten, dass sie solch große Themen rational überblicken können, noch sollten wir ihnen die Verantwortung dafür auf ihre kleinen Schultern legen. Als Erwachsene müssen wir manchmal Entscheidungen zugunsten der Familie treffen, in denen wir nicht explizit die Wünsche aller berücksichtigen können und die dennoch zum Wohle der Familie getroffen werden. An vielen Punkten des Alltag können wir gemeinsam entscheiden, an einigen nicht.
Es ist nicht möglich, das Machtgefälle zwischen Eltern und Kindern vollständig aufzuheben. Wenn sich Eltern der Verantwortung entziehen und Kindern gänzlich die Führung überlassen oder alles gleichwertig aushandeln wollen, kann das je nach Alter des Kindes zur Überforderung führen.
Susanne Mierau „Frei und unverbogen“, S.187
Schuldgefühle nicht die Führung übernehmen lassen
Manchmal müssen Eltern daher Entscheidungen treffen, die sie rational gut begründen können, die aber dennoch im Kind eine andere Reaktion als Dankbarkeit, Freude oder Verständnis hervorrufen. Vielleicht entsteht Ärger, Wut, Zorn, Enttäuschung, Trauer oder Frustration. Dieses Empfinden des Kindes kann wiederum Schuldgefühle beim entscheidenden Elternteil hervorrufen: Die Worte, das Verhalten oder die Gefühle des Kindes werden als Kritik wahrgenommen, lassen vielleicht Zweifel aufkommen an den eigentlich wichtigen und richtigen Entscheidungen. Schnell wird dann versucht, die rationalen Gründe gegenüber dem Kind zu verteidigen, anstatt auf die Gefühle des Kindes einzugehen: „Du musst doch verstehen, dass ich das für uns getan habe!“, „Du wirst dich über dein Geschwisterkind schon noch freuen, wenn du später mit ihm spielen kannst.“ oder es wird versucht, von dem Gefühl des Kindes abzulenken, indem wir die Folgen der Entscheidung in den Vordergrund stellen: „Wenn wir erstmal umgezogen sind, gehen wir dort in die große Eisdiele und du wirst sehen, wie toll das ist.“
Dem Kind die eigenen Emotionen zugestehen
Das Kind braucht jetzt gerade aber keine rationale, erwachsene Erklärung. Die Aufgabe der Eltern ist es auch nicht, das Kind dazu zu überreden, dass es die Entscheidung doch gut findet. Und schon gar nicht sollten die Gefühle des Kindes jetzt übergangen werden. Vielmehr ist es die Aufgabe des Elternteils, diese scheinbare Unvereinbarkeit auszuhalten: „Ich habe eine Entscheidungen zugunsten der Familie getroffen und weiß, dass sie richtig ist. Trotzdem lasse ich die Gefühle meines Kindes zu und helfe ihm durch diese Gefühle hindurch.“ Es ist okay, dass das Kind wütend/traurig/enttäuscht ist. Manchmal gehört es zum Elternsein dazu, auszuhalten, dass das Kind einen gerade nicht mag oder die Entscheidungen infrage stellt. Es hat ein Recht auf diese Gefühle. Und auch wenn wir sie mit unserer Entscheidung mit ausgelöst haben, sind wir dennoch als Bezugsperson nun an der Seite des Kindes, um es zu unterstützen, damit umzugehen. Durch das Zulassen dieser Gefühle des Kindes kann es sich dennoch bei uns sicher fühlen. Das Kind kann erfahren: Ich kann enttäuscht sein über eine Entscheidung, aber ich werde dennoch umsorgt. Meine Gefühle werden nicht unterdrückt, sie dürfen sein. Und vor allem erfährt es: Ich kann mich auch mit Kritik an meine Bezugsperson wenden. Ich werde auch dann geliebt, wenn ich eine andere Meinung habe. All meine Gefühle haben hier Raum und ich kann sie mitteilen, ohne sie verstecken zu müssen.
Eure
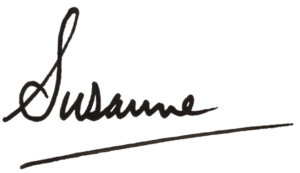
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und tragen seit über 10 Jahren maßgeblich zur Verbreitung bedürfnisorientierter Erziehung bei. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de