Viel weinende Babys sind für ihre Eltern oft eine besondere Herausforderung. Es ist schwer, ein Baby zu begleiten, das viel und lange weint – körperlich ebenso wie emotional. Viele Eltern fühlen sich hilflos und entwickeln das Gefühl, als Mutter oder Vater nicht kompetent zu sein. Schließlich scheint nichts zu helfen, obwohl sie alles geben. Gedanken wie „Mein Baby weint ständig – und ich kann es nicht beruhigen“ setzen sich fest.
Besonders belastend wird es, wenn Eltern in dieser Situation keine fachliche Unterstützung erhalten, sondern allein durchhalten müssen – sei es, weil sie keine Hilfe finden oder nicht wissen, dass es pädagogisch-psychologische Unterstützung gibt. Dann kann sich das Gefühl, nicht gut genug zu sein, tief verankern – und über die Babyzeit hinaus nachwirken.
Selbstvertrauen entwickeln als Elternteil
Bindung und Beziehung entstehen durch Interaktion. Natürlich ist es wichtig, dass das Baby sich auf die Fürsorge verlassen kann – aber auch das Erleben der Eltern spielt eine große Rolle. Wenn wir spüren, dass wir unser Baby verstehen, dass unsere Reaktion hilft, dann entsteht ein Gefühl von Sicherheit und Kompetenz. Fehlt dieses Feedback, wird es schwerer, Selbstvertrauen in der Elternrolle aufzubauen. Stattdessen schleichen sich Zweifel ein – manchmal auch Angst: „Bald weint mein Baby wieder – und ich werde wieder nicht wissen, was hilft.“
Stress, Schlafmangel, Hilflosigkeit, Schamgefühle und Frustration begleiten viele Eltern durch diese Zeit. Innerlich bröckelt das Selbstwertgefühl. Das Gefühl von Selbstwirksamkeit verblasst. Und gleichzeitig wirkt der gesellschaftliche Druck: „Jetzt hast du doch ein Kind – sei doch glücklich!“
Viele fragen sich: „Was denken andere von mir, wenn ich mein Baby nicht beruhigen kann? Was bin ich für eine Mutter, was für ein Vater – wenn ich gleich zu Beginn scheitere?“
Entspannte Eltern, entspannte Kinder?
„Entspannte Eltern, entspannte Kinder“ – noch immer hält sich dieser Spruch hartnäckig, auch wenn er ein Mythos ist. Die Ursachen für das viele Weinen können vielfältig sein. Durchaus können elterliches Verhalten und Stress einen Einfluss nehmen, aber es gibt auch viele weitere mögliche Gründe für das Weinen und Schreien von Babys. Hier braucht es fachkundige Abklärung, um dem Weinen auf die Spur zu kommen.
Und manchmal gibt es keine eindeutige Erklärung. Dann geht es in der Begleitung vor allem darum, die Eltern zu stärken – emotional, körperlich, mental. Damit sie durchhalten können, ohne auszubrennen. Damit sie Auswege kennen, bevor Überlastung zur Lebensgefahr wird: Überforderung kann schwerwiegende Folgen haben, etwa in Form von Schütteln des Babys. Prävention ist hier essenziell. Eltern müssen wissen, was sie ganz konkret tun sollten, wenn ihre innere Not zu groß wird.
Langfristige Auswirkungen
Manchmal bleibt das Vertrauen in die eigene Kompetenz auch nach der Babyzeit erschüttert. Zu sehr und zu lange wurde verinnerlicht, dass man einfach nicht richtig wisse, was das Kind braucht. Zu sehr ist man vielleicht auch daran gewöhnt, Vieles im Wechsel anbieten zu müssen, damit irgendwas hilft. Zu tief sitzt vielleicht auch die Angst vor dem Weinen des Kindes, das so viel Stress verursacht hat und das man mittlerweile fürchtet. Das Stress auslösende Weinen unbedingt vermeiden, kann ein unbewusstes Ziel sein. Kommt ein weiteres Baby in die Familie, kann die Angst vor dem Weinen sich auch auf dieses übertragen – auch wenn es vielleicht kein viel weinendes Baby ist, wie das Geschwisterkind zuvor. Oft ist es nicht sichtbar und bewusst, wie sehr die herausfordernde Zeit geprägt und welche Auswirkungen sie auf das Verhalten genommen hat.
Der Blick auf das Baby UND die Eltern ist wichtig
Die Begleitung von Familien mit viel weinenden Babys darf nicht beim Baby enden. Es geht nicht nur darum, das Weinen zu verstehen oder zu lindern. Genauso wichtig ist der Blick auf die Eltern: Wie geht es ihnen jetzt gerade? Was brauchen sie an Pausen, Unterstützung, Entspannungsmethoden? Was brauchen sie an Hilfen, um sich trotz der aktuell schwierigen Lage kompetent zu fühlen und nicht das Vertrauen in sich zu verlieren? wo erfahren sie sich dennoch als wirksam in der neuen Rolle und erleben schöne Momente des Miteinanders?
Bleibt diese Art der Unterstützung aus, kann eine Ängstlichkeit und Unsicherheit zurückbleiben, die sich auf den Familienalltag auswirkt. Kinder mit einem „schwierigen Temperament“ haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, unsichere Bindungsmuster zu verinnerlichen, weil durch die Herausforderung die Eltern-Kind-Interaktion beeinträchtigt werden kann. Passende Unterstützung kann dies jedoch verhindern und sichere Beziehungen entstehen lassen trotz der großen Herausforderung, die mit der anfänglichen Belastung einher gehen: Sichere Beziehungen sind möglich – auch nach einem schweren Start.
Eure
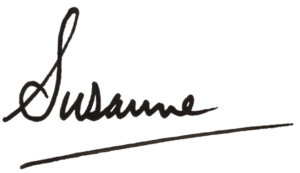
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und tragen seit über 10 Jahren maßgeblich zur Verbreitung bedürfnisorientierter Erziehung bei. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.


