Der Begriff „Selbstregulation“ ist gerade viel zu hören, spätestens seit die Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina vorgeschlagen hat, die Förderung der Selbstregulationskompetenzen zu einer Leitperspektive des Bildungssystems zu machen. Schnell denkt man dabei an „Beruhigung“. Aber ganz so „einfach“ ist es nicht: Selbstregulationskompetenz besteht aus mehreren Facetten.
Was ist eigentlich Selbstregulationskompetenz?
Selbstregulation meint die Fähigkeit, sich so zu steuern, dass man mit dem zurechtkommt, was das Leben im Moment abverlangt und gleichzeitig den eigenen Zielen treu bleibt. Für Kinder heißt das: Aufmerksamkeit bündeln, Frustration aushalten, Impulse sortieren, Entscheidungen treffen, die jetzt und später sinnvoll sind. Es geht um bewusstes Handeln, das auf Wahrnehmung, Wahl und Reflexion basiert.
Wichtig: Selbstkontrolle ist nur ein Teil der Selbstregulation. Genauso bedeutsam sind Gefühlskompetenz, flexible Zielanpassung, Perspektivwechsel und das Wissen, wie man sich selbst unterstützen kann.
Mehrere Ebenen arbeiten zusammen
Für Selbstregulation müssen verschiedene Fähigkeiten zusammenspielen: kognitiv (Informationen zum Sachverhalt erfassen, Arbeitsgedächtnis nutzen, kognitiv flexibel umschalten, Impulse hemmen), emotional (Gefühle wahrnehmen, benennen und so beeinflussen, dass sie nicht überrollen), motivational (Ziele auswählen, Prioritäten klären, dranbleiben gestützt durch Selbstwirksamkeit), und sozial (Verhalten in Beziehung zur Umgebung denken, Reaktionen anderer verstehen, Konflikte verhandeln, Hilfe annehmen).
Vorteile von Selbstregulationskompetenz
Durch all diese Prozesse ist es möglich, den eigenen Handlungsspielraum zu vergrößern: Mit der Umwelt kann bewusst umgegangen werden, Aufmerksamkeit und Gefühle können bewusst gestaltet werden, wodurch es leichter ist, zu lernen, Stress zu verarbeiten und Beziehungen zu gestalten. Studien zeigen, dass Selbstregulationskompetenz mit dem psychischen Wohlbefinden, körperlicher Gesundheit, Bildungserfolg und sozialer Teilhabe in Verbindung steht.
Wie Selbstregulationskomepetenz entsteht
Durch die Aufzählung all der Bausteine wird schnell klar: Das können Kinder nicht von heute auf morgen. Sie entwickelt sich über Jahre, zuerst in Co-Regulation mit nahen Bezugspersonen, dann zunehmend eigenständig. Babys sind zunächst auf uns angewiesen: Wir regulieren, spiegeln Empfindungen, geben Worte und zeigen Wege. Kleinkinder probieren eigene Strategien, lernen durch Begleitung und kognitive Reifung. Im Kindergarten- und Grundschulalter wird im Kopf geplant, Zwischenschritte werden gemerkt, Strategien gewählt: hier wächst auch Metakognition (über das eigene Lernen nachdenken). In der Jugend wird es dann komplexer: intensivere Gefühle, Peer-Dynamiken, größere Ziele – all das muss integriert werden. Das Gehirn reift in den dafür wichtigen Bereichen bis in die 20er Jahre.
Was Kinder von uns brauchen
Was Kinder von uns brauchen sind: Verständnis, Entwicklungsraum und Begleitung, feinfühlige Beziehungen, Unterstützung, Autonomie- und Kompetenzerleben – das fördert Selbstregulation nachweislich. Strukturen geben Orientierung, ohne einzuengen. Unsere Sprache hilft dabei: Gefühle benennen, nächste kleine Schritte planen, Strategien besprechen. Vorleben wirkt dabei stärker als Vortragen: Wie wir mit eigenen Gefühlen, Fehlern und Pausen umgehen, prägt. Und auch der Kontext ist wichtig: Schlaf, Bewegung, Ernährung, außerfamiliäre Betreuung und Schule, Stress und Armutserfahrungen beeinflussen die Entwicklung des Kindes.
Eine Langzeitaufgabe der vielen kleinen Momente
Selbstregulation ist kein Projekt, das man schnell abhakt. Man kann nicht eine Einheit „Selbstregualtion“ jeden Tag einbauen und hoffen, dadurch allein würde sich dieser komplexe Prozess entwickeln. Sie wächst im Alltag in den vielen kleinen, unaufgeregten Momenten zwischen Nähe und Autonomie, Struktur und Freiheit, Üben und Nachsicht. Wenn wir den Blick von „mein Kind soll sich zusammenreißen“ hin zu „mein Kind lernt gerade, sich innerlich zu steuern“ verschieben, handeln wir automatisch hilfreicher: weniger Druck, mehr Begleitung; weniger Bewertung, mehr gemeinsame Lösungswege. So entsteht das, worum es im Kern geht: ein inneres Navigationssystem, das Kinder sicherer durch ihre Welt trägt, heute und morgen.
Eure
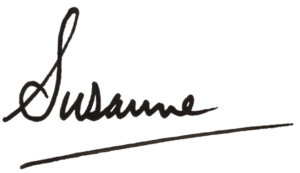
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich der Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für Eltern, die Kinder bindungssicher begleiten und die eigenen Bedürfnisse dabei nicht aus dem Blick verlieren wollen. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen. Sie arbeitet in eigener Praxis in Eberswalde.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de

