„Mein Kind rennt einfach immer weg und auch wenn ich ‚Stopp‘ rufe, hört es nicht.“ – Diese und ähnliche Aussagen höre ich immer wieder. Oft verbunden mit der Frage: Aber was mache ich nun, damit es nicht mehr wegrennt? Auch als Mutter kenne ich das – dieses Hinterherrennen. Diese Angst an der Straße. Ich kenne und benutze den Begriff „schützende Gewalt“ dafür, wenn ein Kind festgehalten werden muss, damit es nicht auf die Straße rennt oder in einen Fluss fällt oder ähnliches. Es ist anstrengend. Und wir wissen, dass Kleinkinder Gefahren nicht absehen können, dass sie Zeit nicht einschätzen können und nicht wissen, wie schnell ein Auto bei ihnen sein kann auf der Straße. Eltern wissen, dass sie sich den Mund fusselig reden müssen, um Kindern die Regeln dieser Welt zu erklären – immer und immer wieder über Jahre hinweg. Und gleichzeitig müssen wir auch noch andere Dinge in den Blick nehmen: die kinderunfreundliche Umwelt und den Umstand, dass Kinder sich auch erproben müssen – und dazu gehört auch der Umstand, sich allein zu fühlen und wieder Nähe herzustellen.
Wenn die Welt kinderfreundlicher wäre
Wenn Eltern mir von stressigen Situationen in Beratungen erzählen und wie sie sich als schlechte Eltern fühlen, weil sie ihre Kinder ständig ermahnen müssen oder „Nein“ sagen, frage ich sie, was sein müsste, damit sie anders handeln könnten. Oft kommt die Antwort, dass der Ort anders sein müsste. Sicherer. Für das Zuhause empfehle ich Eltern daher oft eine „Ja-Umgebung“, so dass sie möglichst wenig „Nein“ sagen und weniger in Anspannung sein müssen. Auch für Draußen lässt sich fragen, wie es sein müsste, damit man entspannter als Elternteil agieren kann. Und auch hier ist die Antwort oft: Sicherheit. Die geringe Kinder- und Familienfreundlichkeit macht es Eltern oft schwer, ihren Kindern die Freiheit einzuräumen zur freien Bewegung, die sie brauchen und eben auch einfordern. Das führt oft zu Konflikten aufgrund von elterlichen Ermahnungen: Die Vorstellung des jungen Kindes und der Eltern treffen aufeinander, das Kind kann jedoch die andere Perspektive noch nicht übernehmen und vom eigenen Bewegungsbedürfnis Abstand nehmen, woraus sich ein je nach Kind intensiverer Konflikt ergibt.
Ein anderes Beispiel für strukturelle Gewalt gegenüber Kindern ist der Straßenverkehr, der nicht nur eine Gefahr für Kinder darstellt, sondern zudem die Bewegungsfreiheit von Kindern einschränkt und ihre Möglichkeiten, sich selbständig (insbesondere in Städten) zu bewegen und unbegleitet mit anderen Kindern zu bespielen.
Susanne Mierau „Frei und unverbogen“
Kinderfreundlicher als Spielplätze in Straßennähe sind oft Naturorte wie Wald und Felder, wo sich Kinder nach ihrem Wunsch bewegen können – und auch einmal ein Stück weiter wegrennen oder sich verstecken können.
Außer Sicht sein ist nicht per se schlecht
Manchen Eltern fällt es allerdings auch schwer, das Kind aus dem Nahbereich zu entlassen. Eltern müssen immer wieder innerlich emotional mitwachsen mit der fortschreitenden Entwicklung des Kindes. Das bedeutet auch, dem Kind mehr Freiraum zuzugestehen für Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit. Das ist ist nicht immer einfach. Besonders schwer kann es auch dann sein, wenn man selbst negative Erfahrungen gemacht hat, die einen auf die Welt mit Angst blicken lassen und überall Gefahren entdecken.
Doch Kinder brauchen die Möglichkeit, aus dem sicheren Hafen aufzubrechen zu Erkundungen und dann bei Bedarf wieder zurückkommen zu können in wohlwollende Arme. In diesem Kreislauf lernen sie gleichermaßen Selbständigkeit und Verbundenheit. Das Kleinkind hat bereits eine innere Präsenz der Bezugspersonen und weiß, dass diese weiterhin existieren, auch wenn sie gerade nicht in Sicht sind. Das Spiel mit der Rückkehr ermöglicht die Erfahrung, die Welt zu erleben und wieder aufgenommen zu werden. Und es ermöglicht, Sicherheit zu gewinnen: Die Welt ist ein guter Ort, in dem ich mich frei bewegen kann. Ich muss keine Angst haben.
Die Welt ist ‚gut‘, sie ist dem Kind mit seinem Forschungsdrag und dem Rückhalt seiner Eltern zu einem sicheren Ort geworden. […] Durch diese Art vorübergehender Trennung und dem ‚Wiederfinden‘ wird dem Kind die Welt, in der es lebt, zunehmend zum sicheren Ort.
Claus Koch „Schutzfaktor Bindung“
Anspannung selbst regulieren
Anstatt zu fragen „Wie kann ich mein Kind dazu bringen, nicht mehr wegzurennen und bei mir zu bleiben?“ können wir uns also auch fragen, warum das Wegrennen und Wiederkommen vielleicht gerade bedeutsam sind und wie wir dies gefahrlos in den Alltag integrieren können. Vielleicht können wir Orte schaffen oder finden, an denen das Wegrennen und Wiederkommen zelebriert werden kann, an denen auch ein Kleinkind sich einmal für einen kurzen Moment sicher verstecken kann, die Aufregung dieser Entfernung dann selbst in sich regulieren kann – bevor es wieder zurückkommt. Im Spiel des Wegrennens oder Versteckens wird schließlich nicht nur die Welt erkundet, sondern auch das eigene Innere: Wie fühlt sich das an, wenn gerade meine Bezugsperson nicht zu sehen ist und wie gehe ich damit um? Kann ich mein Gefühl regulieren? Brauche ich Hilfe und rufe nach jemanden? Renne ich zurück? Und werde ich dann wieder liebevoll aufgenommen und fühle mich sicher bei meiner Bezugsperson aber auch darin, dass diese mir erlaubt, die Welt zu erkunden?
Eure
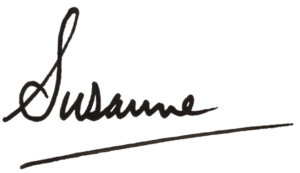
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich der Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für Eltern, die Kinder bindungssicher begleiten und die eigenen Bedürfnisse dabei nicht aus dem Blick verlieren wollen. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen. Sie arbeitet in eigener Praxis in Eberswalde.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de

