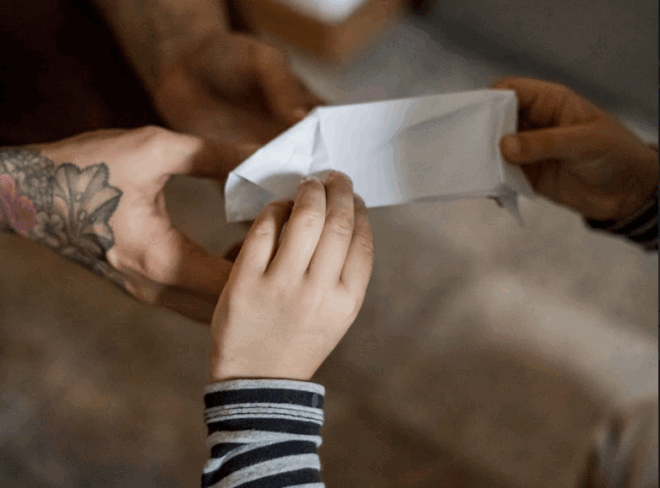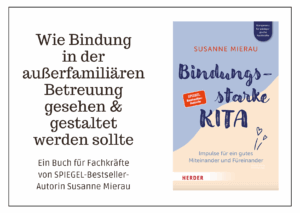Der Übergang vom Kindergarten in die Schule ist für viele Familien ein großer Meilenstein: Mit der Einschulung beginnt ein neuer Abschnitt im Leben des Kindes und der Eltern. Zwischen Neugier, Freude, Stolz und Aufregung mischen sich manchmal auch Unsicherheiten, Sorgen oder Traurigkeit. All diese Gefühle dürfen sein. Wichtig ist, ihnen Raum zu geben – bei den Kindern, aber auch bei uns selbst.
Übergänge sind emotionale Prozesse
Übergänge bedeuten immer Veränderung. Und Veränderung geht nicht nur in eine Richtung: Es geht nicht nur vorwärts, sondern auch etwas zu Ende. Für Kinder ist der Kindergarten oft ein Ort gewesen, an dem sie über Jahre hinweg eine sichere soziale Gruppe hatten. Auch wenn nicht alle Freundschaften gleich eng waren, war diese Gruppe ein stabiles Gefüge. Der tägliche Kontakt, die bekannten Abläufe, die vertrauten Fachkräfte – das gab Sicherheit. Mit dem Schuleintritt verändert sich nun vieles. Selbst wenn manche Freundschaften bleiben, gehen andere auseinander. Vielleicht bleibt ein enges Freundeskind in der Kita zurück oder besucht eine andere Schule. Für Kinder kann das bedeuten, dass es viele Abschiede zu erleben gibt.
Trauer zulassen, nicht überdecken
Als Erwachsene fällt es uns manchmal schwer, kindliche Trauer auszuhalten. Vielleicht, weil wir selbst gelernt haben, dass Abschiedsschmerz möglichst schnell überwunden werden sollte, dass er vielleicht gar nicht sichtbar sein sollte, oder weil uns das eigene Unbehagen einholt. Schnell sind wir dann dazu verleitet, abzulenken mit der Vorfreude auf die Schule, die Geschenke, dem neuen Schulranzen und all den anderen Dingen, die da gerade bevorstehen und die sicherlich spannend, neu und besonders sein werden.
Doch Trauer braucht Raum. Sie ist das Gefühl des Loslassens, welchem wir im Laufe des Lebens immer wieder begegnen. Kinder brauchen Bezugspersonen, die ihnen zeigen, dass auch Trauer sein darf und wir nicht falsch sind, wenn wir trauern und mal nicht (nur) glücklich sind. Wenn Kinder keine Möglichkeit haben, ihre Traurigkeit über das Ende der Kindergartenzeit auszudrücken, kann sich das Gefühl ins Verhalten verschieben: Rückzug, Wut, vielleicht ein Rückfall in frühere Entwicklungsstufen („wieder klein sein wollen“). All das kann auch Ausdruck innerer Trauer sein. Statt auf dieses Verhalten weiter negativ zu reagieren, vielleicht zu schimpfen, abzuwerten, zu bestrafen, sollten wir noch einmal genau hinsehen: Wie geht es dir gerade? Was steckt eigentlich hinter dem Verhalten?
Die elterliche Haltung: Gefühle nicht übertragen
Auch für Eltern sind Übergange wie dieser emotional: Sie bedeuten Abschied von einer intensiven, vertrauten Phase. Vielleicht haben auch Eltern sorgen darum, ob sich das Kind gut eingewöhnen wird, ob es neue Freundschaften aufbauen kann, ob es zurechtkommen wird. Vielleicht vermissen sie lieb gewonnene Rituale aus der Kitazeit und die Ansprechpersonen. Auch diese Gefühle der Erwachsenen sind wichtig. nur wenn wir als Erwachsene unsere eigenen Gefühle anschauen und annehmen, können wir sie von denen des Kindes unterscheiden. So gelingt es uns, nicht aus einem eigenen inneren Stress heraus zu agieren, sondern präsent und stabil an der Seite des Kindes zu sein.
Gemeinsam durch die Übergangszeit
Kinder spüren, wenn etwas im Umbruch ist. Sie brauchen in dieser Zeit unsere liebevolle Präsenz, unsere Geduld und unsere Authentizität. Es ist entlastend, wenn sie erleben dürfen: Auch Mama oder Papa ist berührt vom Abschied. Aber sie können gut damit umgehen. So erleben Kinder ihre Eltern als sicheren Hafen inmitten der Veränderung. Hilfreich kann es sein, gemeinsam Rituale des Abschieds zu gestalten: das Freundebuch, ein liebevoll gestalteter letzter Kindergartentag. Auch ein Abschiedsbrief und die gemeinsame Arbeit daran kann sehr berührend sein. Und wenn Tränen fließen? Dann dürfen sie fließen.
Fazit: Gefühle brauchen Raum
Der Schuleintritt ist ein bedeutender Schritt. Kinder brauchen in dieser Zeit Erwachsene, die ihre Gefühle ernst nehmen und mittragen, ohne sie zu überlagern. Sie brauchen uns nicht nur als Organisator*innen des Übergangs, sondern als emotionale Anker. Je mehr wir auch unsere eigenen Gefühle bewusst wahrnehmen, desto besser können wir genau das sein.
Eure
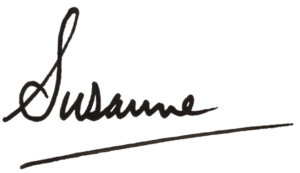
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und tragen seit über 10 Jahren maßgeblich zur Verbreitung bedürfnisorientierter Erziehung bei. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.
Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de